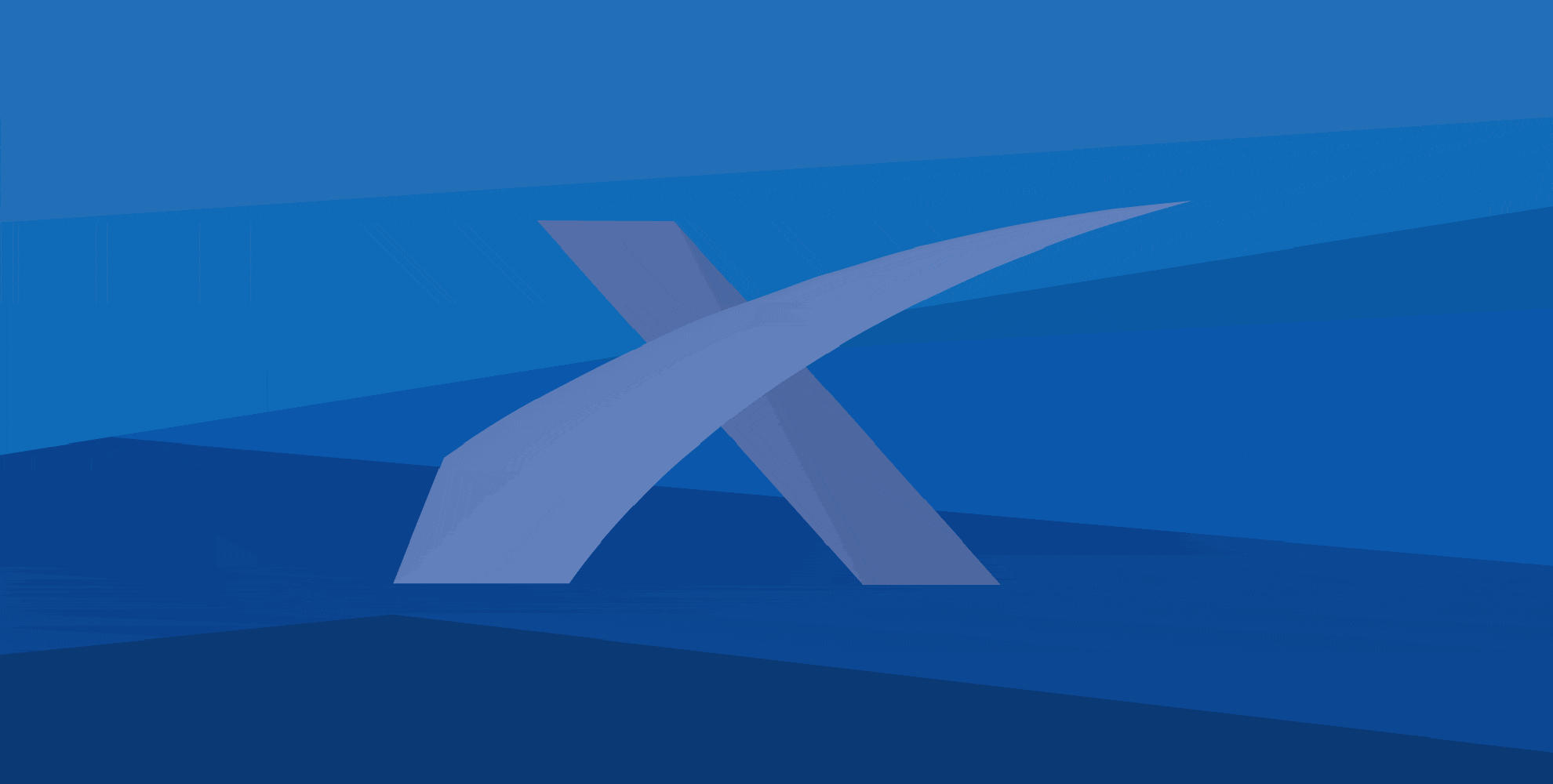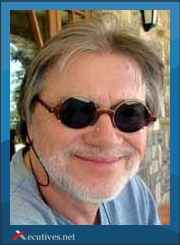
Art Paul
Arthur Paul Huber (mit Künstlername Art Paul), geboren 1940 in Wien, lebt seit über 40 Jahren in der Schweiz. Art Paul hat in den letzten Jahrzehnten über 2’000 Kompositionen geschrieben, u.a. für Werbefilme, Lieder für die Basler Fasnacht und diverse Theater. Einem breiteren Publikum bekannt wurde Art Paul durch seine jahrzehntelange musikalische Arbeit als Arrangeur und Komponist für das Fauteuil-Theater in Basel aber auch durch seine Tätigkeit als Komponist für den Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt. Art Paul hat auch als Kabarettist auf der Bühne gestanden. Sein Freund und Mentor Georg Kreisler räumte ihm für seine Kabarett-Auftritte die Rechte an seinen Liedern ein und gab ihm den letzten Schliff. Im Gespräch mit Christian Dueblin erzählt Art Paul über seinen musikalischen Werdegang, die Basler Fasnacht, den Schweizer Humor und spricht von seinen Erfahrungen aus der Welt der Musik und des Kabaretts.
Dueblin: Art Paul, wie fanden Sie den Zugang zur Musik, die Sie das ganze Leben lang begleitet hat?
Art Paul: Ich habe in den 50iger-Jahren in Wien, wo ich aufgewachsen bin, am Konservatorium Musik studiert. Zu meinen bevorzugten Instrumenten gehörte die Klarinette aber auch das Klavier. Ich wurde auch in Kontrapunkt und Komposition unterrichtet. Ich hätte als junger Musiker bei den Philharmonikern in Wien einsteigen können. Der Jazz hat mich aber schon damals viel mehr interessiert als die klassische Musik. Schliesslich bekam ich von den Amerikanern, die in Deutschland stationiert waren, im Jahr 1958 ein Angebot als Jazz-Pianist in einem Trio und ging nach Frankfurt a.M. in den dortigen Officers Club, wo wir jeden Abend spielten.
Dueblin: Sie waren also der Club-Pianist der dortigen Offiziere.
Art Paul: Ja, ich war mit meinen Musikern für die Unterhaltung der amerikanischen Vorgesetzten und ihrer Gäste zuständig. Das ging damals noch ganz anders zu und her als heute. Es wurden viele Feste gefeiert und die Jazz-Musik erfreute sich bei diesen Menschen einer ungemeinen Beliebtheit. Ich profitierte von der ganzen Infrastruktur der Amerikaner. Obwohl der Krieg erst etwa zehn Jahre zurücklag und es in Deutschland noch an vielem mangelte, hatten wir Musiker bei den Amerikanern alles, was unser Herz und auch unser Magen begehrten (lacht). Ich spielte aber auch in anderen Ländern für die Amerikaner, etwa in Marokko und in Schweden. Dieser Tätigkeit ging ich rund fünf Jahre lang nach.
Dueblin: In der Schweiz gab es keinen amerikanischen Officers Club. Was führte Sie Ende der 50iger-Jahre in die Schweiz?
Art Paul: Ich lernte 1959 meine erste Frau, eine Baslerin, kennen und verbrachte immer mehr Zeit in dieser Stadt. Wir heirateten, und ich suchte mir meine ersten Engagements in der Schweiz. Es waren also keine musikalischen Motive, die mich in die Schweiz führten. Die Schweiz wirkte auf mich sehr ruhig und schon fast besinnlich. Auf einmal war der ganze Rummel der Amerikaner weg, und ich konnte mich auf meine eigenen Projekte konzentrieren. Ich komponierte sehr viel. Davon zu leben war am Anfang sehr schwierig. Meine Arbeit als Komponist wurde aber mit der Zeit eine lukrative Sache. Bald hatte ich die Möglichkeit, Werbespots zu vertonen, die Unternehmen für das Schweizer Fernsehen produzierten. Meine Kunden waren sehr zufrieden mit meiner Arbeit, und die Tätigkeit als Werbekomponist wurde für rund fünfzehn Jahre meine Haupteinnahmequelle. Irgendwann kam Roland Rasser, der damalige Eigentümer des Fauteuil-Theaters in Basel, auf mich zu und fragte mich, ob ich an der Nachfolge von Hans Möckel, er war der Chef-Musiker des Theaters, interessiert sei.

„Cabaret Kaktus“ im Tobourettli in Basel, (v.l.n.r.) Rolli Rasser, Colette Greder, Bernhard Baumgartner, Dominique Lendi (c) Art Paul
Dueblin: Hans Möckel war ein bekannter Mann in der Schweiz. Er leitete Big Bands und spielte für das Radio. Vielen Menschen dürfte die Melodie von der Sendung „Persönlich“ am Schweizer Radio bekannt sein. Das ist doch ein Stück aus der Feder von Hans Möckel, oder nicht?
Art Paul: Ja, das ist richtig. Wir haben uns mit der Zeit sehr gut kennengelernt, und ich lernte einiges von ihm. 1974 wurde dann im Fauteuil-Theater das erste „Pfyfferli“ aufgeführt, eine mittlerweile typische und traditionelle Basler Vorfasnachtsveranstaltung. Ich hatte für diese Produktion viel komponiert. Ich blieb dem Fauteuil-Theater 36 Jahre lang treu. Die Musik für die meisten Eigenproduktionen, die in diesem Theater gespielt wurden, habe ich komponiert. Damit verdiente ich mir mein Leben.
Dueblin: Sie haben damals als klassisch ausgebildeter Musiker aus Wien mit einem Faible für Piano-Jazz und eben von den Amerikanern kommend das erste Mal die Fasnacht in der Schweiz und im Speziellen in Basel erlebt. Wie wirkte die Fasnacht auf Sie?
Art Paul: Das war fürchterlich! (Lacht) Dieses schrille Pfeifen überall, der Lärm und das Durcheinander. Ich hatte das alles anfänglich nicht verstanden. Ich konnte auch den Rhythmus vieler Fasnachtsmärsche nicht feststellen. Erst später bemerkte ich, wie unglaublich traditionell und originell die Fasnacht ist und was an Engagement der Bevölkerung dahintersteckte. Ich fing an, das wahre Wesen der Fasnacht zu begreifen.
Es war im Jahre 1966, da wollte ich selber anfangen, Piccolo, eine kleine Flöte, die an der Basler Fasnacht verwendet wird, zu pfeifen. Ich trat der Barbara-Clique, einer Fasnachtsvereinigung, bei und wollte ein Preispfeifen gewinnen. Ich wurde beim Wettkampf nur die Nummer 82, worauf ich das Pfeifen wieder aufgab (lacht). Die Liebe zur Basler Fasnacht blieb aber bis heute bestehen. Ich schrieb auch Fasnachtsmärsche, die heute noch oft gespielt werden. Darunter findet sich, für die Menschen, die sich etwas auskennen, das „Lisettli“ oder „Das Dreiörgeli“. Wir haben mit Fasnachtsmusik auch viel experimentiert. So habe ich auf einer alten Silbermann-Orgel im Elsass gespielt, begleitet von Piccolos. Es waren damals die besten Pfeifer in der Stadt (Bajass-Clique). Diese Mischung aus Piccolo und Orgelpfeifen war sehr speziell. Das waren „Versuchsballons“, die sich beim Publikum grosser Beliebtheit erfreuten.
Dueblin: Sie haben mir vor vielen Jahren einmal erzählt, dass Sie auch mit Friedrich Dürrenmatt zu tun hatten. Können Sie uns etwas über diese Begegnung erzählen?
Art Paul: Egon Karter vom Theater Basel hatte mich damals mit Dürrenmatt bekannt gemacht. Ich wohnte in einem Haus im Gerbergässlein, unweit vom Theater. Dürrenmatt kam manchmal zu mir nach Hause, und wir fingen an, uns über Musik und Gott und die Welt zu unterhalten. Ich habe in der Folge für das Stück die „Die Panne“ aber auch für die „Die Physiker“ und „Achterloo“ die Bühnenmusik komponiert. Diese Musik kam an gewissen, von Dürrenmatt genau definierten, Stellen der Stücke vor. Heute bekomme ich hin und wieder einige Franken oder auch Dollars, denn es kommt vor, dass diese Musik noch zu Aufführungen von Dürrenmatt-Stücken gespielt wird und ich Tantiemen erhalte, wie kürzlich aus New York (lacht).
Ich war öfters in Neuenburg bei ihm in seinem Haus. Da wurde zuerst einmal eine Flasche Bordeaux getrunken. Wir unterhielten uns über die Stücke, und ich erklärte ihm meine Ideen. Er war ein Berner, der langsam sprach, sehr geistreich und gebildet. Ich erinnere mich gut an diese Gespräche. Dürrenmatt war eine grosse Persönlichkeit, ein Denker. Er hat mich mein ganzes Leben lang inspiriert. Er tut das auch heute noch.
Dueblin: Art Paul, irgendwann in Ihrem Leben haben Sie sich mit Kabarett angefreundet und nicht nur Kabarett als Musiker untermalt, sondern auch selber Kabarett gespielt und gesungen. Höhepunkt war wohl das Programm „Wiener Schnitzel“. Darin führten Sie auch Nummern von Georg Kreisler auf. Wie lernten Sie diesen Superstar des Kabaretts und des schwarzen Humors kennen?
Art Paul: Georg Kreisler lernte ich ebenfalls durch Egon Karter kennen, genau wie zuvor Dürrenmatt. Ich fing an mit Sabine Rasser – der Tochter des alten HD-Läppli alias Alfred Rasser – Kabarett zu spielen. Georg Kreisler lieferte auf meine Anfrage hin irgendwann zwei Stücke, die sehr gut ankamen. Er beabsichtigte 1995 nach Basel zu ziehen, und ich sollte ihm eine Wohnung suchen, was ich auch tat. Später kaufte er eine grosse Villa und lud dort immer wieder interessante Menschen zu Konzerten und Diskussionen ein.
Georg Kreisler ist meines Erachtens der Bühnenvater des deutschen Kabaretts! Er kam irgendwann zu mir und sagte: „Mach doch auch mal selber Kabarett!“ Kreisler hatte mich dann lange Jahre „gecoacht“, wie man so schön sagt. Er hat jeden Satz und jede Note aus seinen Stücken mit mir durchexerziert und mich überall korrigiert, wo das nötig war. Das war eine sehr intensive aber auch sehr bereichernde Zeit.

Art Paul mit Georg Kreisler in Palm Springs (USA) (c) Art Paul
Dueblin: Was war und ist Georg Kreisler für ein Mensch?
Art Paul: Kreisler war unerhört erfolgreich und ist ein Genie. Man muss wissen, dass Kreisler in Wien und Amerika eine klassische Klavierausbildung absolvierte. Er war ein absolut brillanter Pianist, spielte Mozart, Beethoven und Chopin, alles ohne Fehler und absolut tadellos. Dann war er mit dieser Stimme gesegnet, die wie gemacht war für seine Lieder. Schliesslich ist er ein sehr intellektueller Mensch, dem die Ideen nicht ausgehen. Er wurde mit seinen Nummern und Produktionen sehr reich. Allerdings musste er ganz unten anfangen. Er stammt auch aus Wien und zog 1938, als sich der Zweite Weltkrieg abzeichnete, nach Hollywood. Er ist Jude und hatte dort einen Onkel, der für die Filmindustrie arbeitete. Er lernte in Amerika eine Frau kennen, seine erste Ehefrau. Sie war die Tochter von Friedrich Holländer, dem berühmten Dichter und Komponisten. Heute wohnt Georg Kreisler in Salzburg.
Dueblin: Sie selber hatten nicht nur Erfolg im Leben. Sie sind stark herzkrank und waren schon klinisch tot. Kann man so ein Schicksal als Kabarettist besser überstehen als andere Menschen?
Art Paul: Ich kann das nicht ändern und muss das mit einer Prise schwarzem Humor hinnehmen (lacht). Das fällt mir als Kabarettist möglicherweise etwas leichter als anderen. Ich stand einige Male mit einem Bein im Sarg und war tatsächlich auch schon einmal über drei Minuten klinisch tot. Ich leide an einer nichtheilbaren Herzkrankheit und trage schon seit vielen Jahren einen implantierten – mittlerweile der vierte – Defibrillator mit mir. Sobald mein Herz versagt, was leider schon passiert ist, produziert dieses Gerät Elektroschocks, die mein Herz wieder animieren. Das regt zum Denken an. Ich ging darum, als ich über die Krankheit aufgeklärt war, zwei Jahren auf eine Weltreise, da ich nicht wusste, wie lange ich noch zu Leben hatte. Wie Sie sehen bin ich immer noch da. Heute lebe ich von meiner Musiker-Pension und beziehe meine AHV. In der Freizeit male ich Bilder und organisiere hin und wieder eine Ausstellung. (Anmerkung der Redaktion: Die nächste Ausstellung findet am 6., 7. und 8. Februar 2009 in der Alten Post in Riehen BS statt.)
Dueblin: Sie haben sich ihr Leben lang mit Kabarett und Humor auseinandergesetzt. Was denken Sie ist heute in Bezug auf Kabarett und Humor anders als noch vor einigen Jahrzehnten?
Art Paul: Das Kabarett richtet sich an eine Elite, wobei der Ausdruck „Elite“ etwas hochgestochen ist. Vielleicht müsste ich es umgekehrt sagen: Kabarett richtet sich nicht an die grosse Masse. Es fordert den Zuhörer heraus. Er muss mitdenken. Denken Sie an das Projekt „Scheibenwischer“ von Dieter Hildebrandt. Das ist typisches und sehr hochstehendes Kabarett. Sie können diese Texte, Wortspielereien und Witze nicht verstehen, wenn Sie nicht irgendwie über die politischen Verhältnisse in Deutschland informiert sind. Man braucht somit ein gewisses Vorwissen. Nur dann erkennt man die Pointen und kann darüber lachen.
Ich stelle fest, dass heute viel Comedy und weniger Kabarett betrieben wird. Stefan Raab etwa – ich persönlich kann mit seinen Sendungen nichts anfangen – ist ein Mann der Comedy. Seine Scherze und Witze sind Schenkelklopfhumor. Das Fernsehen will möglichst viele Menschen auf einmal erreichen. Da können Sie nicht allzu kritisch und qualitativ hochstehend daherkommen. Es ist wie beim Essen: Sie können nicht für tausend Menschen an einem Fest scharfen grünen Curry kochen (lacht). Sie müssen den Geschmack verflachen! Raus kommt dann etwas, das man zwar Essen kann, dem aber die spezielle Würze fehlt. Ein guter Koch oder ein Kabarettist will es nicht allen Menschen Recht machen. Er orientiert sich am Publikum, das sein Produkt zu schätzen weiss.
Ich stelle auch fest, dass immer mehr Menschen gerne einen „Schwank“ im Theater anschauen, also ein lustiges Theaterstück. Damit haben Kleinkunst-Theater heute Erfolg, und damit verdienen sie ihr Geld. Ich schaue mir auch solche Stücke an. Sie sind sehr lustig, aber es ist nicht Kabarett, was gezeigt wird. Fredi M. Murer hat in einem Ihrer Interviews darauf hingewiesen, dass die Zeiten des politischen Films vorbei seien. Ich sehe das auch in Bezug auf das politische Kabarett so. Die Menschen kommen abends nach Hause, nach einem stressigen Tag. Sie wollen sich dann in der Regel nicht mit politischen und heiklen Themen auseinandersetzen. Man sucht die Erholung und das Vergnügen und will abschalten. Ich flüchte, wenn ich fernsehe, oft in die Welt des englischen Humors und schaue mir Sendungen am englischen Fernsehen an. Da gibt es wunderbare Sendungen mit wunderbarem englischem Humor, die meines Erachtens qualitativ sehr hochstehend sind.
Dueblin: Gibt es Ihres Erachtens in der Schweiz gute Kabarettisten und genügend Nachwuchs?
Art Paul: Ich glaube, dass dem so ist. Ich sehe auch im Fauteuil-Theater in Basel immer wieder junge Menschen, die gut sind und immer besser werden können. Es braucht viel Einsatz und Durchhaltewille. Oft will man von Künstlern nur etwas sehen, wenn sie schon bekannt sind. Die Zuschauer scheinen oft nicht zu erkennen, dass man auch jüngeren Künstlern irgendwann eine Chance geben muss. Aber ich bin zuversichtlich, dass unsere Jungen das hinbekommen! Aber schauen wir mal zurück: An der Premiere in Basel von Klaus-Dieter Hüsch, das war ungefähr im Jahre 1957, gerade als das Fauteuil-Theater gegründet wurde, waren keine zwanzig Personen anwesend. Es war also auch damals nicht einfach.
Man muss aber auch beachten, dass die Jungen einen anderen Humor haben, der einfach anders gestrickt ist. Es gibt meines Erachtens den klassischen Humor, also beispielsweise Lieder von Georg Kreisler, Friedrich Holländer oder der Comedian Harmonists, der wohl auch in hundert Jahren noch gut ankommen wird. Andere Facetten des Humors aber verändern sich mit der Gesellschaft, beispielsweise die Produktionen von Victor Giaccobo, für mich einer der grossen Humoristen und Kabarettisten der Schweiz. Das gilt selbstverständlich auch für seinen Bühnen-Partner Mike Müller.
Dueblin: Sie sind vor vielen Jahrzehnten in die Schweiz gekommen. Haben Sie damals einen typischen schweizerischen Humor erkannt?
Art Paul: Ich denke schon, dass es diesen speziell schweizerischen Humor gibt. Er entspringt den diversen Dialekten, die man in der Schweiz spricht. Rein vom gedanklichen Inhalt eines Witzes her gesehen jedoch, denke ich nicht, dass sich der schweizerische Humor etwa vom deutschen Humor unterscheidet. Emil Steinberger hat es verstanden, den Schweizer Humor mit viel Dialekt auch in Deutschland erfolgreich und sehr beliebt zu machen. Wenn man lange auf der Bühne steht und Menschen zum Lachen bringen will, kann es vorkommen, dass man völlige Blackouts hat oder das Publikum in einem Moment nicht erreicht, also nicht lustig rüberkommt. Was macht man in solchen Situationen als Profi?
Das kommt schon vor, dass man an einem Abend, aufgrund der Mischung zwischen einem speziellen Publikum und der eigenen Verfassung, nicht ankommt. Es gibt einige Tricks, die man anwenden kann. Man muss sich, wenn einzelne Lacher im Publikum erkennbar sind, an diese lachenden Personen halten. Falsch wäre das Umgekehrte, also verzweifelt zu versuchen, das restliche Publikum zu gewinnen. Wenn einzelne Personen lachen, ziehen die anderen bald nach. Es kommt vor, dass Menschen im Theater sitzen, die sagen: „So, jetzt habe ich bezahlt, nun mach mal was, so dass ich lachen kann!“ (Lacht) Es ist nicht immer einfach, diese Erwartungshaltung befriedigen zu können. Schwierig kann es auch sein, wenn ganze Vorstellungen von Unternehmen gebucht werden. Es kann dann vorkommen, dass alle erst dann lachen, wenn die Direktoren lachen.
Dueblin: Und was macht man bei einem Blackout? Ich denke etwa an das Lied von Georg Kreisler, in dem er alle tschechisch klingenden Namen aus dem Wiener Telefonbuch singend erzählt, und man plötzlich mitten drin vor dem Publikum den Faden verliert?
Art Paul: Das ist ein ganz besonders lustiges Stück. Es sind ja nur Namen, wohl 200 an der Zahl, die einen zum Lachen bringen. Aber diese ganze Masse von Namen – tschechische und böhmische – in alphabetischer Reihenfolge machen den Reiz des Liedes aus. Ich ging, um dieses Lied auswendig zu lernen, nach Mallorca. Ich erinnere mich gut an diese Zeit in meinem Hotelzimmer, jeden Tag einige Zeilen mehr lernend, bis das Lied fest im Kopf war.
Die Lieder müssen so gut sitzen, dass man sie reflexartig singen und spielen kann. Es kommt trotzdem manchmal vor, dass man irgendwann den roten Faden verliert. Man kann dann dem Publikum einfach lachend erklären, dass man es noch einmal von vorne versuche, oder man geht einfach zum nächsten Lied über. Mit der Zeit lernt man improvisieren. Kann man das, dann passiert es, dass ein Publikum den Fehler gar nicht erkennt und meint, es sei alles geplant. Das nenne ich die hohe Schule der Improvisation. (Lacht)
Dueblin: Art Paul, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch, wünsche Ihnen Gesundheit und weiterhin viel Spass und Freude bei Ihren Tätigkeiten!
(C) 2009 by Christian Dueblin. Alle Rechte vorbehalten. Anderweitige Publikationen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors gestattet.