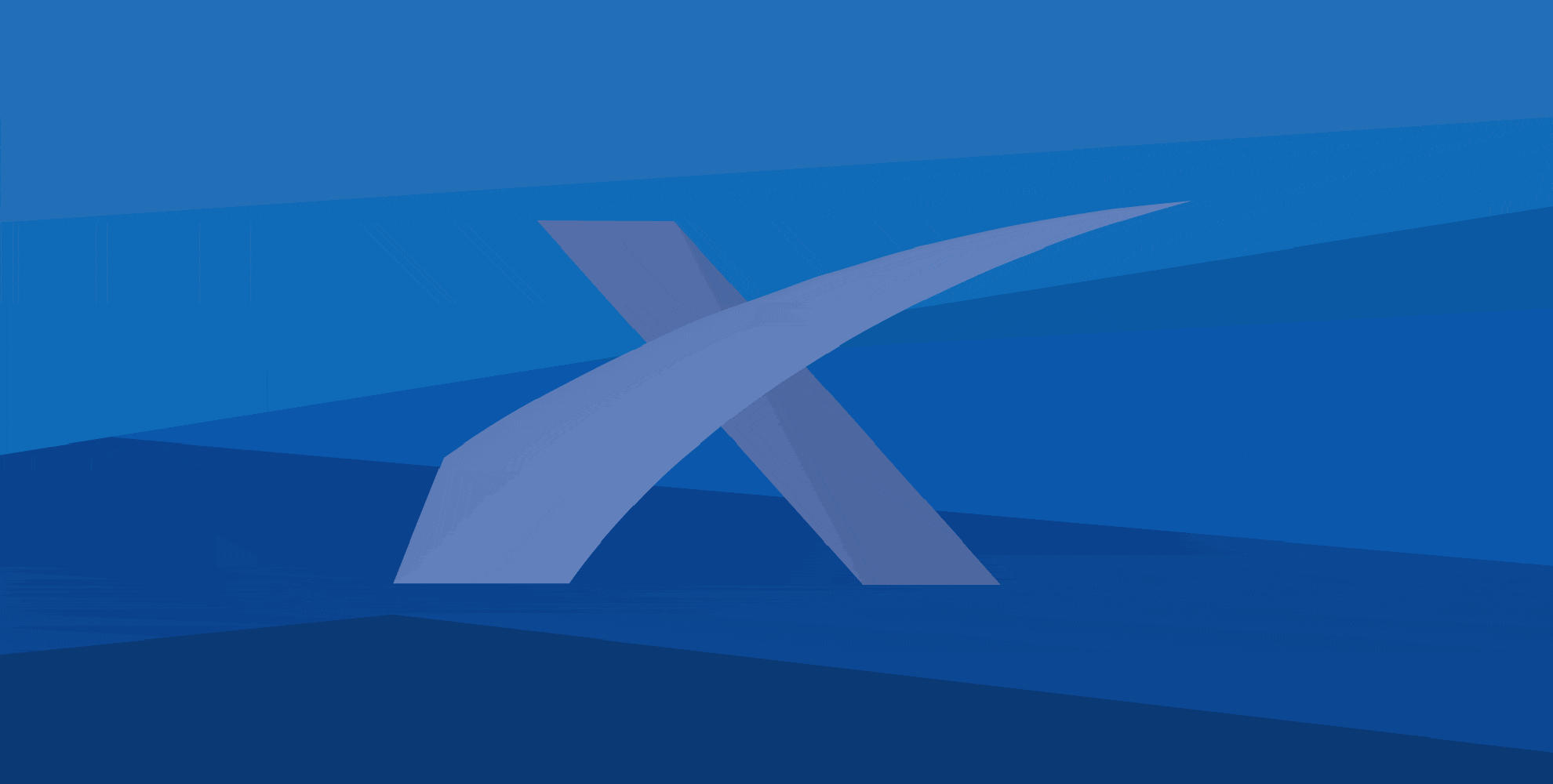Bettina Eichin (c) Max Galli
Bettina Eichin, Jahrgang 1942, von Basler Eltern in Bern geboren, in Bern und Fribourg aufgewachsen, wollte Anfang der Sechzigerjahre Bildhauerin werden. Weil es damals in Bern keine Kunsthochschule gab, begann sie 1960 eine Steinbildhauerlehre. Um mehr zu lernen, setzte sie die Lehre in der Münsterbauhütte Bern fort und wurde 1964 erste Steinmetzin der Schweiz. Ihr bekanntestes Werk ist die „Helvetia auf der Reise“ auf der Mittleren Brücke in Basel, eine Bronzeskulptur, die mittlerweile Kultstatus erreicht hat und in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag feiern konnte. Aber auch die „Neun Musen“ in Freiburg i.Br., „Menschenrechte 1776,1789,1791“ im Bundeshaus in Bern, der „Verenabrunnen“ in Zurzach, die „Markttische“ im Kreuzgang des Basler Münsters, der „Mathias von Neuenburg Brunnen“ in Neuenburg am Rhein (D) und der Brunnen gegen die Zollfreistrasse in Riehen sind Werke, mit denen Bettina Eichin nicht nur Schönheit ausdrückt, sondern auch Botschaften vermittelt. Bettina Eichin gehört heute zu den bekanntesten bildenden Künstlerinnen. Im Interview mit Christian Dueblin gibt sie Einblicke in ihr Leben und in ihr Kunstverständnis, spricht über Hochs und Tiefs in ihrer Karriere und zeigt die Hintergründe und Entstehungsprozesse ihrer Skulpturen auf.
Dueblin: Frau Angela Rosengart hat im Interview mit Xecutives.net sehr schön die Schnittstelle zwischen Kunstmarkt und Kunst beschrieben. Was beobachten Sie als seit vielen Jahrzehnten tätige und sehr erfahrene Künstlerin, die stets eigene Wege beschritten hat, heute in Bezug auf Kunst und den Umgang mit ihr in der Gesellschaft und wo sehen Sie Unterschiede zur Kunst zur Zeit der Impressionisten und Expressionisten, die heute wieder sehr gefragt ist.
Bettina Eichin: Das lässt sich nicht einfach beantworten. Zur Zeit der Vormoderne und der klassischen Moderne, auf die Frau Rosengart im Gespräch eingeht, war die Welt sicherlich viel übersichtlicher als heute. Die Kunstzentren waren Paris, Wien, Berlin, später auch New York. Künstler, Kunsthändler sowie Sammler waren in Kontakt, beobachteten und kannten sich oft persönlich. Von den Zentren angezogen, bewegten sie sich eng beieinander, was sehr befruchtend war. Nach der Katastrophe 2. Weltkrieg ging das noch eine Weile so weiter. Wer sich beispielsweise mit dem Leben von Alberto Giacometti befasst, sieht mit Erstaunen, wen er in Paris alles getroffen hat – berühmte Schriftsteller, Künstler, Mäzene, Kunsthändler, Sammler, viele interessante Persönlichkeiten. Die Welt hat sich aber generell, nicht nur in Bezug auf die Kunst, verändert. Alles ist durch die immer weiter fortschreitende Globalisierung und die Macht von Markt und Medien unübersichtlich geworden.
Dueblin: Waren es denn die besten Künstler, die wir heute aus der Vor- und klassischen Moderne in Museen und Galerien antreffen, und sind es die besten Künstler, die wir heute in den Medien verfolgen und deren Werke wir in Galerien sehen können? Haben nicht der Zufall und auch das „Marketing“ schon in der Zeit der Vormoderne eine ganz wesentliche Rolle gespielt?
Bettina Eichin: Es sind nicht immer die besten der jetzt lebenden Künstler, die heute an die Spitze kommen bzw. die höchsten Preise auf dem Kunstmarkt erzielen. Vieles in Bezug auf den Erfolg eines Künstlers hängt heute mehr als früher mit Zufällen und vor allem mit Marketing zusammen. Heute wird vergleichsweise von viel mehr KünstlerInnen viel mehr Kunst erzeugt als damals und es wird immer schwieriger, in dieser Masse gute und „nachhaltige“ Kunst zu finden.
Sicher gibt es einzelne Künstler und vor allem Künstlerinnen, die man schon damals nicht zur Kenntnis nahm, die schnell vergessen gingen und erst heute wiederentdeckt werden, und natürlich gab es schon damals Künstler, die wussten, wie man sich wirksam verkaufen kann. Viele Kunsthändler haben die Kunstschaffenden damals in den Ateliers und in den Kunstzentren aufgesucht, sie mit Ankäufen unterstützt und sind wie Frau Rosengart im Interview schön aufzeigt, dabei auch erhebliche Risiken eingegangen. Heute ist das meines Erachtens anders. Es geht oft nur noch um den materiellen Wert der Kunst und es gibt kaum mehr Galerien und Sammler, die sich für regionale Kunst engagieren. Ganz deutlich macht sich diese Tendenz auf internationalen „Hitlisten“ bemerkbar. Es geht dabei vorwiegend darum, welche Kunst von welchem Künstler für wie viel verkauft oder versteigert wurde. Damit ist die Kunst zum Spekulationsobjekt geworden. Der Künstler Damien Hirst beispielsweise hat seine eigenen Werke ersteigert und die Preise damit ins Astronomische gehievt. Er wollte offensichtlich feststellen, wie viel der Markt für seine Kunst hergibt. Ob es sich dabei um eine künstlerische Provokation handelt, bei der Galeristen und Sammler munter mitmachen, in der Hoffnung, viel Geld zu machen, sei dahingestellt.
Was die klassische Moderne anbelangt denke ich aber schon, dass die Künstler und wenigen Künstlerinnen, deren Werke wir heute in den Museen bewundern können, die Besten ihrer Zeit waren und mit ihren Werken Bleibendes geschaffen haben. Die Kunst war damals aber viel mehr als heute eine Geistesbewegung mit gesellschaftlicher Relevanz. Die Künstler standen vor und mitten im Aufbruch in eine neue Zeit. Viel Neues wurde erprobt – Fotografie und Film, neue Drucktechniken, Zeitungen, Radio und Grammophon, Architektur, Forschung, Wissenschaft, neue Chemie- und Agrartechniken, Industrialisierung, Eisenbahn, Auto, Flugzeuge, nicht zu vergessen Demokratisierung, Kapitalismus und Sozialismus. Mit den Schrecken der beiden Weltkriege haben Nationalismus und Kolonialismus bis heute tiefe und grausame Spuren auf der ganzen Welt hinterlassen. All das hatte auch Auswirkungen auf die Kunst.
Dueblin: Wie gehen Sie persönlich mit der Kunst und dem Kunstmarkt, wie Sie ihn beschreiben, um?
Bettina Eichin: Ich habe mich diesem Markt gar nie gestellt, weil ich ihn nicht brauchte und er mir nichts bedeutet hat. Die Bildhauerei war weniger auf Galerien angewiesen als etwa die Malerei. Die Galeristen waren an Skulpturen wenig bis gar nicht interessiert. Heute ist das anders. Viel Skulptur wird heute über die Kunsthändler platziert und sie ist zu einem lukrativen Grossgeschäft geworden. Ich habe mir meinen Namen über jurierte Ausstellungen und Wettbewerbe gemacht. Ich glaube, das geht heute gar nicht mehr.
Vor 10 oder 20 Jahren war es für mich noch einfacher, meinen Weg allein zu gehen und abseits vom Kunstzirkus zu stehen. Ich hatte meine kleine Nische, aus der ich herausstrahlen konnte, wie es mir gefiel. So konnte ich meine künstlerische Unabhängigkeit behalten, ohne in Gefahr zu geraten, einem Trend oder einer Mode nachjagen zu müssen. Dieses Abseitsstehen wird jedoch immer schwieriger. Heute fühle ich mich als Dinosaurier im Keller, ohne Taschenlampe. Es gibt kaum mehr Bildhaueraufträge für Kunst im öffentlichen Raum. Bildhauerei wie ich sie betreibe, ist wenig gefragt, wird als „Möblierung“ abgewertet und als überflüssig abgetan. Grosse Aufträge, die einen Künstler oder eine Künstlerin über längere Zeit beschäftigen, gibt es kaum mehr. Gefragt sind Konzepte mit kurzfristigen Interventionen im öffentlichen Raum, die kommen und gleich wieder verschwinden, ohne Spuren zu hinterlassen. Die Architekten sind heute die Bildhauer. Mit ihren Grossobjekten stellen sie die Skulpturen im öffentlichen Raum und binden die Finanzmassen. Plätze, Parkanlagen und Brunnen werden heute nicht mehr mit KünsterInnen gestaltet. Sie werden heute von den Architekten und Gestaltern selbst designed. Was ich mit Bild, Form, Inhalt und Aussage mache, würde das reine Design stören.

Bettina Eichin: „Neun Musen“ zu Gast an der Uni Basel 2008. Foto: Max Galli
Dueblin: Symbolisieren Ihre Neun Musen, die in Freiburg i.Br. betrachtet werden können, was Sie eben beschrieben haben? Die Neun Musen, Göttinnen des Gedächtnisses und der Erinnerung in der griechischen Mythologie, Töchter des Zeus und der Mnemosyne, machen in Ihrem Werk Rast und scheinen müde und aufgrund ihrer Erfahrungen auch etwas desillusioniert zu sein.
Bettina Eichin: Nein, sie sind nicht enttäuscht, sie denken nach. Mich hat an allegorischen Frauenfiguren vor allem interessiert, wieso es überhaupt weibliche Allegorien gibt. Ich wollte wissen, ob da Frauen gemeint sind und wertgeschätzt werden, oder ob der Mann die Frau einfach nur für gewisse Aussagen und Ideale benutzt. Mir wurde allmählich klar, dass es bei den Allegorien nicht um Frauen per se geht, dass das Frauenbild nur genommen wird, um Tugenden und deren Versinnbildlichung darzustellen, denn in der Realität – in der Politik und in der Kulturgeschichte – spielt die Frau ja nur eine untergeordnete bis gar keine Rolle. Die weiblichen Allegorien zeigen also Ideale auf, an die sich die Männer in der Lebenspraxis nicht halten.
Die Neun Musen als Göttinnen von Erinnerung und Gedächtnis kamen schon sehr früh als Lehrerinnen auf den Olymp, weil sich die ungebildeten, rohen Götter ohne Sprache, Klang, Bewegung und Bildung langweilten und nichts mit sich, dem Olymp und der Welt anzufangen wussten. Mich beschäftigte auch die Frage, warum Apoll, wenn er in Sachen Kultur auftritt, eine Lyra trägt und die Neun Musen anführt. Geht es aber um Leben, Tod und Krankheit tritt er alleine auf. Die Musen hingegen können zu neunt, in Gruppen oder alleine auftreten und brauchen den Musenführer Apoll für ihren Auftritt nicht. Und dann kommt natürlich noch eine persönliche Erfahrung als Bildhauerin dazu: Während männliche Künstler sich Musen selbstverständlich zulegen und sich rundherum versorgen und küssen lassen, blieb der jungen Frau und Bildhauerin damals nur, sich selbst Muse zu sein (lacht).
Dueblin: Warum braucht es Ihres Erachtens denn ein solches Aufgebot an Frauen und warum sind es nicht Männer, welche diese Inhalte und Aufgaben versinnbildlichen?
Bettina Eichin: Die Antwort liegt in der Erinnerung und im Gedächtnis. Das beachtliche Aufgebot in der griechischen (nicht römischen!) Mythologie von neun Frauen in Sachen Natur, Kunst, Politik, Landwirtschaft, Wissenschaft – alles Göttinnnen der Erinnerung und des Gedächtnisses mit olympischem Rang – hat mich sehr beeindruckt. Die Mutter der Musen ist Mnemosyne, auch sie Göttin für Erinnerung und Gedächtnis. Sie hat die Sprache erfunden und hat die Dinge benannt. Auf Klang, Bewegung, Rhythmus, Berührung, Sprache und Benennen von Dingen basiert die ganze Erziehung – oder besser gesagt die Heranbildung eines Menschen. Wenn Sie Ihre kleine Tochter betrachten, übt sie mit Nachahmung ihr Gedächtnis und ist dabei individuell kreativ.
In der griechischen Gesellschaft war die Männer- von der Frauenwelt strikte getrennt. Ab dem 5. Lebensjahr kamen die Knaben zu den Männern, um das Streit- und Kriegshandwerk zu erlernen. Was die Kinder aber für ihr Leben brauchten, ist ihnen bis zum 5. Lebensjahr von den Frauen vermittelt worden. Darum sind die Frauen das kulturelle Gedächtnis der Menschheit. Ich interpretiere das als Feministin folgendermassen: Die griechische Mythologie mit den Neun Musen – diese Vielzahl von Göttinnen – steht dafür, dass Erinnerung und Gedächtnis weibliche Qualitäten und für die menschliche Entwicklung unabdingbar sind. Jede musische Disziplin bedingt eine eigene Spezialisierung des Gedächtnisses. Durch Nachahmung und „Memorierung“ lernt das Gedächtnis seinen Talenten entsprechend und schafft Neues.
Wir leben heute jedoch im zweiten Jahrhundert einer gedächtnislosen, beschleunigten und überbilderten Gesellschaf inmittten öffentlicher und privater Kriege und machen erinnerungslos in rasendem Tempo unseren Planeten kaputt. Wenn wir unsere Wirtschafts- und Politikführer betrachten, scheuen und vermeiden sie nichts so sehr wie Erinnerung, Erfahrung und Verantwortung. Nehmen wir beispielsweise den Fall Tschernobyl: Wir bauen ungeniert weitere Kernkraftwerke und können mit den Risiken aber nach wie vor nicht umgehen. Nicht von ungefähr musste Sigmund Freud die Psychoanalyse erfinden, um wenigstens therapeutisch das private individualisierte Gedächtnis bzw. Seelen zu retten. Meine Neun Musen küssen nicht, sind nicht leichtfüssig und haben nichts zu lachen. Es sind neun in schwere Tücher gehüllte Frauen, die nachdenken, träumen, sich erinnern und sich durch die leidvolle Geschichte der Völker und ihre Kriege mühen – inter arma silent musae (im Krieg schweigen die Musen).

Bettina Eichin: „Helvetia auf der Reise“. Foto: Dieter Hofer
Dueblin: Auch ihr bekanntestes Werk, die „Helvetia auf der Reise“ in Basel, ist eine Frauen-Allegorie. Sie ist ihr bekanntestes Werk und ist heute nicht mehr von der Mittleren Brücke wegzudenken. Wie viele Ihrer Werke vor allem im öffentlichen Raum vermittelt auch die Helvetia eine Botschaft. Was ist es, was die Helvetia aussagen will?
Bettina Eichin: Ich wollte aus der Helvetia-Allegorie auf unseren Münzen wieder eine Frau machen, sie aus der Festprägung befreien, aussteigen lassen – genauso, wie wir Frauen damals. Nur ganz wenige Menschen haben vor 30 Jahren verstanden, was ich mit der Helvetia ausdrücken wollte. Einer war der damalige Basler Regierungsrat Arnold Schneider. Er begriff auf Anhieb, was ich mit der Helvetia sagen wollte und begrüsste wie Rumpelstilzchen den emanzipatorischen Ansatz des Werkes. Andere Menschen fanden sie einfach nur echt baslerisch originell oder angenehm anzuschauen. Damals wurde eine Botschaft in einem Kunstwerk strikte abgelehnt. Es war absolut verpönt, mit Kunst etwas Politisches zu sagen oder auf ein gesellschaftliches Anliegen aufmerksam zu machen. Kunst mit einer sogenannten „Botschaft“ wurde nicht als Kunst anerkannt. Realistische Kunst wurde verdächtigt, sozialistisch, faschistisch oder bestenfalls historistisch zu sein. Was gefallen könnte, durfte nicht sein und wurde sofort zur Nichtkunst degradiert. Kunst ist aber immer auch Sprache, ein Kommunikationsmittel, und ich wollte mit der Helvetia eine Geschichte erzählen. Um sie lesbar zu machen, wählte ich das realistische Bildmittel. Ich würde meinen Realismus als poetischen oder lyrischen Realismus bezeichnen.
Dueblin: Die Figur Helvetia hat das Zweifrankenstück verlassen und sie schaut vom Zuschauer abgewendet sehr nachdenklich rheinabwärts. Hinter ihr sind Schild und Speer, aber auch ein Koffer. Gab es keine Reaktionen wie bei der Weltausstellung in Sevilla 1992, als man an die Wand malte: „La Suisse n’éxiste pas.“ Gerade Menschen, die sich damals daran gestossen haben, könnten denken, die Helvetia wolle sich von der Schweiz abwenden?
Bettina Eichin: (Lacht) Nein, auf die Idee kam damals noch niemand. Erst später bin ich mit einer merkwürdigen Aussage konfrontiert worden. 1986 feierte die Sandoz A.G. ihr 100 Jahr-Jubiläum. Sie hatte bei mir einen Marktplatzbrunnen als Geschenk für die Stadt Basel bestellt. Daran arbeitete ich, als die Brandkatastrophe von Schweizerhalle die Region Basel aufschreckte und erschütterte, Gift in den Rhein floss und der Name Sandoz in aller Munde war. Versuchen Sie sich vorzustellen, in welch schwieriger Lage ich war: Auf der einen Seite des Rheins sass meine „Helvetia auf der Reise“. Sie wurde Tag und Nacht, monatelang mit Blumen, Kerzen, Transparenten und anderen Attributen zum Treffpunkt und Symbol der Trauer und des Zorns. Auf der anderen Seite des Rheins, für den Marktplatz, das politische Zentrum, arbeitete ich an einem Trinkwasserbrunnen, im Auftrag der Sandoz A.G. Damals schrammte der Grossraum Basel an einer noch grösseren Katastrophe vorbei – in der Nähe des Brandherdes waren Chlorgas, Phosgen und andere giftige Ungetüme gelagert. Die mussten mit einem monumentalen Wasservorhang geschützt werden. Dieses Löschwasser vergiftete mangels Auffangbecken den ganzen Rhein bis Holland. Wegen des Marktplatzbrunnens kamen nach der Brandkatastrophe zwei Direktoren der Sandoz A.G. zu mir in die Werkstatt. Sie waren gezeichnet von der Katastrophe und es ging ihnen sehr schlecht.
Für mich als Chronistin war es selbstverständlich, dass ich diese Katastrophe, die für Basel ein Kulturschock war, im Werk Marktplatzbrunnen berücksichtige und ein Bild dafür finde. Sie gewährten mir Zeit zum Nachdenken und jede künstlerische Freiheit. Ein Jahr später ging es ihnen besser. Die Sandoz A.G. brillierte mit besten Geschäftszahlen und die Herren erwarteten von mir einen unverfänglichen, hübschen Brunnen auf dem Marktplatz, etwas, wie sie sagten, „Nettes wie die Helvetia auf der Mittleren Brücke“, die sie jedem ausländischen Gast zeigen. Ich schilderte ihnen, was die Helvetia bedeutet und aussagt. Sie steigt aus der Festprägung der Münze, also des Geldes, aus, ist unterwegs, um sich müde, nachdenklich und abgewandt auf ihrem Sockel auszuruhen – Eigenschaften, die an Frauen nicht geschätzt werden. Sie schaut rheinabwärts zur Chemie und über die Grenzen. Sie hat abgerüstet und ihre Hoheitssymbole hinter sich abgelegt, der Koffer ist ein Hinweis auf ihr „Unterwegssein“, auf ein Jahrhundert Kofferpacken, Flucht und Aufbruch. Die beiden Herren waren über meine Ausführungen entsetzt. Einer meinte gar, das sei „staatszersetzend“.
Nach dem Brand von Schweizerhalle setzten sich Chemiekonzerne mit Umweltverbänden an einen Tisch, die Umweltminister der Rheinanliegerländer beschlossen nach Jahren der Uneinigkeit Massnahmen für die Sanierung des Rheins, die Politik rang um schärfere Gesetze, um solche Unfälle in Zukunft zu verhindern. Während der Markttisch auf der einen Seite des Brunnens mit Gemüse, Früchten, Blumen unverändert blieb, wurde der zweite Tisch ein Symbol für das Aushandeln von Verbesserungen und für eine neue Ära der gemeinsamen Verantwortung. Ich räumte den Tisch ab und machte tabula rasa. Der Tisch wurde so frei und Symbol für Neues und Konstruktives. Auf die Holzstruktur des Bronzetisches wollte ich das Datum des Unglücks schreiben: „z.B. „Basel, 1. Nov. 1986, 00.19 h“. Das ist der Titel des heutigen Werkes im Kreuzgang des Basler Münsters, wo die Tische heute stehen. Das hatte zur Folge, dass mir wegen der Nennung des Datums kurz darauf der Auftrag entzogen wurde. Die Stadt Basel musste der Sandoz A.G. zusichern, dass dieser Brunnen auch nicht privat finanziert auf den Markplatz kommt und nahm ein anderes Geschenk in Empfang, ein Bild von Félix Vallotton, das eine Frau mit nacktem Oberkörper und mit ihren Händen auf dem Rücken zeigt. Zensur von Kunst im Öffentlichen Raum durch einen Konzern in einem demokratischen Land? In Basel passte das. Ich hatte keinen Auftrag mehr, keinen Standort und den grossen, eigens für den Brunnentrog gebrochenen Jurakalk verkaufte die Sandoz A.G. sofort nach dem Entzug des Auftrags weiter.
Dueblin: Sie haben die beiden Tische dann aber trotzdem fertiggestellt. Sie können heute im Kreuzgang des Basler Münsters betrachtet werden…
Bettina Eichin: Ich wollte die begonnene Arbeit an den Tischen als grosses Stillleben beenden. Ich musste die Katastrophe, die mich auch gesundheitlich aus der Bahn geworfen hatte, verarbeiten. Dafür brauchte und suchte ich einen Ort. Im Gedicht „Die Vergänglichkeit“ von Johann Peter Hebel, in dem die Apokalypse, das grosse Feuer an der Topografie von Basel grauslich geschildert wird und auch der Kreuzgang vom Basler Münster vorkommt, fand ich meinen Ort. Ich schrieb dieses wunderbare, lange Gedicht auf die Tischplatte. Zu diesem Tisch gehörte schon im ersten Entwurf für den Marktplatzbrunnen eine Trommel mit der Maske und dem Mantel des Basler Todes. Im Kreuzgang ruft sie zusammen mit den zahlreichen Grabzeichen an den Wänden leise zum Totentanz. Zusammen mit dem anderen Tisch, dem Markttisch mit Gemüse, Früchten und Blumen, bilden die beiden Tische im kleinen Kreuzgang seit 1991 ein Ensemble – ein „Memento“ für die Bewahrung der Schöpfung. Damit das Werk damals gegossen werden konnte, wurden mit Hilfe der nach Schweizerhalle gegründeten „Oekostadt Basel“ 100 nummerierte und signierte kleine Bronzeobjekte mit einer Malve vom Markttisch innerhalb weniger Tage verkauft. Damit waren die Gusskosten gesichert. Es dauerte dann fast ein Jahr, bis der Kirchenrat das Aufstellen der beiden Tische erlaubte. Die Denkmalpflege war über die Tische inmitten spätgotischer Architektur nicht „amused“, liess das Aufstellen der Tische dann aber doch unter gewissen Bedingungen zu. Die Tische gehören noch mir und ich wünsche mir, dass sie im Kreuzgang, für den sie geschaffen wurden, bleiben können. Ein Gönnerverein, der die Tische der Basler Bevölkerung schenken möchte, will mir die Tische abkaufen und sammelt seit zwei Jahren Geld. Die Übergabe findet am 1. Dezember 2010 im Kreuzgang statt, im 250. Geburtsjahr des Dichters und Aufklärers J.P. Hebel.

Bettina Eichin: Die Markttische. Foto: Max Galli
Dueblin: Das bedeutet aber auch, dass Kunst offensichtlich auch heute ein Medium ist, das Diskussionen anregt und zumindest dazu führt, dass Themen besprochen werden. Gibt es diese Macht der Kunst Ihrer Meinung nach?
Bettina Eichin: Wenn ein Künstler Kritik äussert und einen Skandal provoziert, steht er am Schluss meistens als Held da. Für mich als Frau war das anders. Die Markttische blieben ein Brandzeichen. Ich habe mich nach dem Auftragsentzug gefragt, wo ich als Künstlerin stehe und was Kunst eigentlich ist. Die Gesellschaft basiert, wenn wir weit in die Kulturgeschichte zurückschauen, auf drei Beinen: Herrschaft, Religion und Bild. Die Bilder geben über Herrschaftsstrukturen und Religion Auskunft. Man kann bis in die frühesten Tage der Menschheit zurückgehen, seit es Bilder gibt, und wird feststellen, dass dem so ist. In neuerer Geschichte z.B. zur Zeit der Reformation wurden Religion und Herrschaft in Frage gestellt – in der Aufklärung noch radikaler, begleitet von Wort, Bild, Wissenschaft, Musik und Revolutionen. Wo stehen wir aber heute? Die Herrschaft ist heute die Wirtschaft, die Religion ist der Konsum und das Bild sind die Medien, die diesen Kreislauf in Schwung halten und beschleunigen. Der Anteil der bildenden Kunst ist, wenn man die Gesamtmenge der Bilder in unserer überfluteten Medienwelt berücksichtigt, völlig marginal. Andere Bilder, Bilder des Konsums, pornographische und gewalttätige, beherrschen die Bilderflut, fördern den Konsum als Religion, mehren und sichern die Herrschaft der Wirtschaft über das Geld. Ich will damit nur aufzeigen, dass die Bilder, die wir als Künstler schaffen von sehr untergeordneter Rolle sind. Es wird für KünstlerInnen, die sich der Herrschaft und dem Konsum in dieser Bilderflut nicht beugen möchten immer schwieriger und enger. Die „Macht der Kunst“, von der Sie sprechen, ist nur ein alter Mythos.

Bettina Eichin in der Giesserei in Pietrasanta. Foto: Max Galli
Dueblin: Sie haben den Beruf der Steinmetzin und auch der Steinbildhauerei gelernt. Wie kam es damals vor 50 Jahren zum Entschluss, sich mit Stein und später auch mit Bronze auseinanderzusetzen?
Bettina Eichin: Ich wollte mit 18 Jahren Bildhauerin und Künstlerin werden und bin aus der Schule ausgetreten. Mein Vater wollte, dass ich die Schule beende oder eine Lehre beginne. Eine Steinbildhauerlehre in Verbindung mit der Kunstgewerbeschule war in Bern damals die einzige Möglichkeit. Die Steinbildhauerei ist ein hartes, schweres Handwerk, das einem weiblichen Körper zusetzt. Ab Mitte der Siebzigerjahre – die Kunst im Öffentlichen Raum wurde damals heftig diskutiert und faszinierte mich – suchte ich nach einem anderen Material, das mir mehr Möglichkeiten für grössere Arbeiten und fürs Geschichten erzählen gibt. Ich fand es in der Bronze. Ich habe eine eigene Arbeitstechnik und Wachsmischung ausgetüftelt, um frei von Gewichten, unabhängig und ohne fremde Hilfe auch grössere Arbeiten bewältigen zu können. Damit erreichte ich jede künstlerische Gestaltungsfreiheit für feinste Nuancen. Ich schärfte meinen Gestaltungswillen an den Themen Frauenfigur, Stillleben und Schrift. Ich bin wohl die einzige Bildhauerin, die das Risiko eingeht, alle Arbeiten in Wachs für den direkten Bronzeguss cire perdue zu formen und zu modellieren, denn das Modell selber oder Teile davon können im Giessvorgang bei kleinsten Fehlern und Unvorsichtigkeiten verloren gehen. Deshalb brauche ich eine sehr zuverlässige, gute Giesserei, wie ich sie in Pietrasanta in Italien gefunden habe.
Während der Lehrzeit nutzte ich jede freie Zeit für eigene künstlerische Arbeiten und war für Studienzwecke ein halbes Jahr in Israel und Griechenland. Nach der Lehre, 1964, war ich ein halbes Jahr auf der Insel Patmos freischaffend tätig, eine wunderbare Erfahrung. Danach arbeitete ich in der Münsterbauhütte in Bern an der Renovierung des Hauptportals. Nach einem Arbeitskonflikt mit der Münsterbauleitung wegen meiner Mitgliedschaft im Bau- und Holzarbeiterverband – eine Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft gehöre sich nicht für eine Frau (es ging um den Minimallohn, den man mir verweigerte) – verliess ich die Münsterbauhütte. Ausgestattet mit guten Kenntnissen in der Restaurierungsbildhauerei arbeitete ich neben meiner Bildhauerei als Restauratorin für Museen, Kunsthandel und auf deutschen Grabungen in Griechenland, wo ich 1966 meinen Mann Gerhard Hiesel, einen österreichischen Archäologen kennenlernte. Ich konnte mich immer mehr meinen eigenen künstlerischen Projekten zuwenden – ab 1978 vor allem Werken im öffentlichen Raum, Frauenfiguren, Brunnen, grösseren und kleinsten Stillleben, Objekten, Installationen und der Schrift.
Dueblin: Sie hätten aber auch Malerin werden können? Warum der Beruf der Steinbildhauerin, den man eher mit Männern assoziiert?
Bettina Eichin: Ich malte und zeichnete immer gerne, habe modelliert soweit ich mich zurückerinnern kann und war im Kindergarten sehr kreativ. Meine Kindergärtnerin hat meine Arbeiten aufbewahrt. Einen Engel und ein Kamel aus dieser Zeit hat mein Vater für mich aufgehoben. Sichtbares schaffen und kreativ sein war mir immer Trost und Ausweg. Ich modellierte ganze Szenen. Meine Zeichnungslehrer durch alle Schulen hindurch halfen mir sehr, Mut für einen eigenen künstlerischen Weg zu finden.
Dueblin: Sie haben ein wichtiges „Gedächtnis“ im Leben, nämlich Ihre Mutter, schon sehr früh verloren. Der Schriftsteller Hansjörg Schneider hat seine Mutter, die ebenfalls früh starb, in seinem wohl besten Werk „Das Wasserzeichen“ beschrieben und seine Beziehung zu ihr darin verarbeitet. Was, denken Sie, hat der frühe Tod Ihrer Mutter für Wunden bei Ihnen hinterlassen und wo erkennt man diese Wunden in Ihrem Schaffenswerk, vielleicht auch in der Helvetia und in den Neun Musen?
Bettina Eichin: Meine Mutter starb, als ich vier Jahre alt war. Sie ist für mich ein wichtiges Thema in meinem Schaffen. Ich habe einen Enkel, der 4 Jahre alt ist, so alt wie ich war, als meine Mutter starb. Ich beobachte ihn genau und geniesse es, mitzuerleben, wie er sich entwickelt. Ich selber habe keine Erinnerung an meine Mutter, eine Lücke, die mich sehr schmerzt. Erinnerung und rekonstruieren ist für mich etwas sehr Wichtiges und Zentrales und hängt mit Gerechtigkeitssinn zusammen. Meine Faszination für Frauenfiguren hat vielleicht damit zu tun, dass ich diese Lücke, die meine Mutter bei mir hinterliess, füllen möchte. Als ich die Helvetia machte, war ich gleich alt wie meine Mutter, als sie starb. Das hat mich sehr beschäftigt. Vielleicht habe ich die Helvetia nach dem inneren Bild meiner Mutter geschaffen? Nach dem Tod meiner Mutter bekam ich eine Stiefmutter wie aus dem Märchen. Ich litt sehr und fühlte mich in meinem Unglück ungerecht behandelt. Auch diese Erfahrung hat sich gewiss auf mein Schaffen ausgewirkt.
Dueblin: Sie sind oft auch angeeckt, wenn Sie auf ihrer künstlerischen Freiheit bestanden haben, auch bei den besagten Tischen und dem Brunnen für die Firma Sandoz. Was hat Sie jedoch angetrieben, in Bezug auf Ihr künstlerisches Schaffen offensichtlich keine Kompromisse einzugehen und auf Geld zu verzichten und sich den Unmut „wichtiger“ Bürger zuzuziehen?
Bettina Eichin: Ich bin von dem, was ich mache, überzeugt und habe immer ein durchdachtes Konzept, wenn ich bildhauerisch tätig bin – und das bin ich mental permanent. Die Bildhauerei ist verglichen mit Zeichnung und Malerei ein sehr langsames Medium. In einer Zeichnung wird eine augenblickliche Idee und Gefühlsregung sofort wiedergeben. Die Frage der Gültigkeit in der Öffentlichkeit stellt sich dabei nicht. Die Bildhauerei dagegen ist ein langer Prozess fortlaufender Entscheidungen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Je grösser die Arbeit, desto unmöglicher wird eine Veränderung. Die Planung, der Standort, der Zeitfaktor, materielle, handwerkliche Bedingungen und Abhängigkeiten, die Zusammenarbeit mit der Giesserei, anderen Spezialisten, Firmen und mit Ämtern begleiten und dominieren die Ausführung einer Idee bis zum fertigen Werk am Standort. Ich muss darum ganz anders planen und prüfen, was eine augenblickliche Idee ist, was bewegt in zehn, zwanzig Jahren noch und hat Bestand, wie bei der Helvetia, den Markttischen, den Menschenrechten und den Neun Musen. Mir wurde oft der Vorwurf gemacht, meine Arbeiten seien sentimental, was als Herabwürdigung, Beleidigung und Vorwurf gemeint war. Ich brauchte etwas Zeit, Sentimentalität dem Wortsinn nach als Selbstverständlichkeit des Ausdrucks, als Qualität zu betrachten und als Kompliment zu verstehen. Meinem Modell für die Helvetia habe ich immer wieder gesagt, sie müsse nicht nur müde dasitzen, sondern sich innerlich richtig müde fühlen. Es war interessant zu sehen, wie sich die Anatomie beim richtig müde fühlen veränderte. Frauen haben eine „innere“ Anatomie, ein inneres Körpergefühl. Das zu erkennen und zu übertragen ist mein Anliegen und lässt die Betrachterinnen sich identifizieren. Wie das bei Männern ist, weiss ich nicht, ich würde daher nie wagen, einen Mann zu formen und darzustellen. Ich probiere an mir selber die Körperhaltungen und dieses innere Körpergefühl aus und arbeite so lange am Ausdruck einer Figur, bis „es“ stimmt. Dass Frauen sich in meinen Frauenfiguren erkennen und sich ihnen nahe und verwandt fühlen, liegt sicher daran. Dieser Arbeitsprozess ist sehr anstrengend und entspricht nicht dem künstlerischen Ansatz vieler männlicher Bildhauer, die in der Regel junge Frauen und schöne Männer nach eigenem Gutdünken für eigene und anderer Männer Bedürfnisse abbilden.
Dueblin: Sie sprechen beim eben Gesagten von sehr „nachhaltigem“ künstlerischen Arbeiten. Viel mehr als bei einem Bild geht es bei Ihren Figuren und Skulpturen aber auch um den Ort, an dem sie stehen. Wie finden Sie den richtigen Ort und was hat er für Ihre Kunst für eine Bedeutung?
Bettina Eichin: Was ist nachhaltig in Bezug auf Kunst? Um nachhaltig arbeiten zu können, muss ich mich sehr lange mit einem Standort und seinem Umfeld auseinandersetzen und mich emotional, historisch und konzeptionell auf ein Werk vorbereiten. Natürlich kommen im Entstehungsprozess auch momentane Eindrücke und Emotionen dazu und fliessen laufend in ein Werk ein. Der Ort aber ist die feste Grösse für die Inspiration. Der Pfeiler beispielsweise, auf dem die Helvetia sitzt, ist sehr exponiert und markant. Die Helvetia hat Aussagekraft und Ausstrahlung nicht nur der Figur wegen, sondern vor allem durch den Standort. Ohne diesen hätte die Figur nie dieselbe Wirkung. Der Kunsthistoriker Dario Gamboni hat für die „Helvetia auf der Reise“ den Begriff geprägt: „C’est le génie du lieu.“ Das trifft den Nagel auf den Kopf. Der Ort ist es, der mit der Figur zusammen eine Aussage verstärken und unterstützten kann. Genauso ist das mit den Markttischen, die im Kreuzgang ihre volle Wirkung entfalten können, deren Standort im Kreuzgang aber leider noch nicht gesichert ist.

Bettina Eichin: „Menschenrechte 1776, 1789, 1791“ im Bundeshaus (mit Ruth Dreifuss). Foto: Max Galli
Dueblin: Da viele Ihrer Werke im öffentlichen Raum stehen, sind die Reaktionen aus der Öffentlichkeit, vielfältig und die Frage des Ortes gestaltet sich schwieriger als etwa bei einem Bild, das in einem Museum hängt. Wie gehen Sie mit dieser Schnittstelle, die schwierig ist, persönlich um?
Bettina Eichin: Mein Drama ist, dass viele wichtige Werke trotz klarer politischer Voten ihren vorgesehenen Standort durch puristische Interventionen von Verwaltungen und ihren Vertretern nicht finden. Die „Neun Musen“ beispielsweise, vom Freiburger Stadtparlament mit einer Stimme Enthaltung in Auftrag gegeben, stehen in Freiburg i.Br. nicht wie geplant auf dem Augustinerplatz, sondern auf provisorischen Holzsockeln als Leihgabe der Stadt eingeklemmt in einem dunklen Durchgang eines Kollegiengebäudes der Universität. Die Skulptur „Menschenrechte 1776,1789,1791“, initiiert durch eine Petition von National- und Ständeräten, steht nicht wie im Jubiläumsjahr 1998 vorgesehen vor den „Drei Eidgenossen“ im Bundeshaus. Die Skulptur kam im Jahr 2000 in einen für Besucher nicht öffentlichen Durchgang. Während der Renovation des Bundeshauses war sie in einem Container bei einer Spedition gelagert und konnte 2008 in einer Ausstellung in der Skulpturhalle Basel gezeigt werden. Fragil und nicht für aussen gemacht, soll das Werk nun im Freien, im offenen Durchgang zwischen Bundeshaus und Bundeshaus West, aufgestellt werden. Das „Menschenrechtsdenkmal“, einstmals von Markus Kutter und der Peter Ochs-Gesellschaft zur Rehabilitation des Basler Revolutionärs Peter Ochs und zur Erinnerung an die unblutige Basler Revolution und an die Helvetik zum Jubiläumsjahr 1998 initiiert und in Auftrag gegeben, sollte im auslaufenden Wegdreieck vom Petersplatze Richtung Universitätsbibliothek Aufstellung finden, weil auf dem Petersplatz 1798 die neue Basler Verfassung beschworen wurde. Dieses Denkmal mit den drei ersten und wichtigsten Menschenrechtserklärungen (von 1776, 1789, der einzigartigen „Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne“ von Olympe de Gouges aus dem Jahr 1792 und der Menschenrechtserklärung der UNO vom 10. Dezember 1948) ist zu 90% fertig gestellt, an vier Orten gelagert und hat in Basel immer noch keinen würdigen Standort gefunden, der inhaltlich, historisch und räumlich stimmt, obschon der Grosse Rat sich mit 2/3 Mehrheit mehrmals für das Denkmal ausgesprochen hat. Das sind ungelöste Aufgaben, die mich immer wieder herausfordern, viel Zeit, Aufwand und Kraft kosten.
Dueblin: Sehr geehrte Frau Eichin, Sie sind nun seit über 50 Jahren als Künstlerin tätig. Was wünschen Sie sich für sich selbst und Ihre Kunst?
Bettina Eichin: Ich wünsche mir für meine Kunst, noch zu erleben, dass die Werke, die im Ungewissen sind, einen ihnen angemessenen bleibenden Standort erhalten. Meine Werkstatt liegt am Rhein und seit Jahren sammle ich Schiffsnamen von Frachtschiffen. Über 800 habe ich schon. Mit all diesen wunderprächtigen Namen, die in die Weite der Welt weisen, möchte ich einen durchsichtigen Bronzeteppich gestalten. Und mit der Erfahrung der alten Frau möchte ich die Neun Musen in Form von drei Dreiergruppen noch einmal schaffen – aber wer will die schon?! Mir selber wünsche ich Gesundheit und Geduld für alles, was noch auf mich zukommt (lacht) und einige fruchtbare Schaffensjahre – ohne Standortprobleme.
Für die nachfolgenden Generationen wünsche ich mir eine gerechte Welt, eine lebbare Umwelt und Frieden. Ich wünsche mir, dass meine Generation, die die momentanen Krisen vorbereitet und verursacht hat, für Gerechtigkeit, Umwelt und Frieden alle Kräfte mobilisiert. Dafür wünsche ich mir weltweit Heere von grauen PantherInnen, die nicht für sich selber, sondern für eine lebenswerte Zeit nach uns sofort auf die Barrikaden steigen und handeln!
Dueblin: Sehr geehrte Frau Eichin, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute bei Ihren Projekten.
Die folgenden Interviews könnten auch interessant sein für Sie:
- Angela Rosengart über ihre Lieblingsmaler Pablo Picasso und Paul Klee sowie über die Geschichte der Galerie Rosengart in Luzern
- Andrea Raschèr – Provenienzforschung früher und heute mit einem Blick auf die Washingtoner Konferenz 1998
- Erwin Wurm über sein künstlerisches Schaffen, seine Skulpturen und was man in seiner Kunst zwischen den Zeilen lesen kann
- Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth über die Würth-Gruppe, den Zusammenhang zwischen Kunst und Unternehmertum sowie Europas Zukunft
- Kaspar M. Fleischmann über die Anfänge der Fotografie, die Fotografie als Kunstform und seinen Visionen für die Fotokunst
- Ansicht über Impressionismus im Jahr 1883
______________________________
Links
– Wikimedia