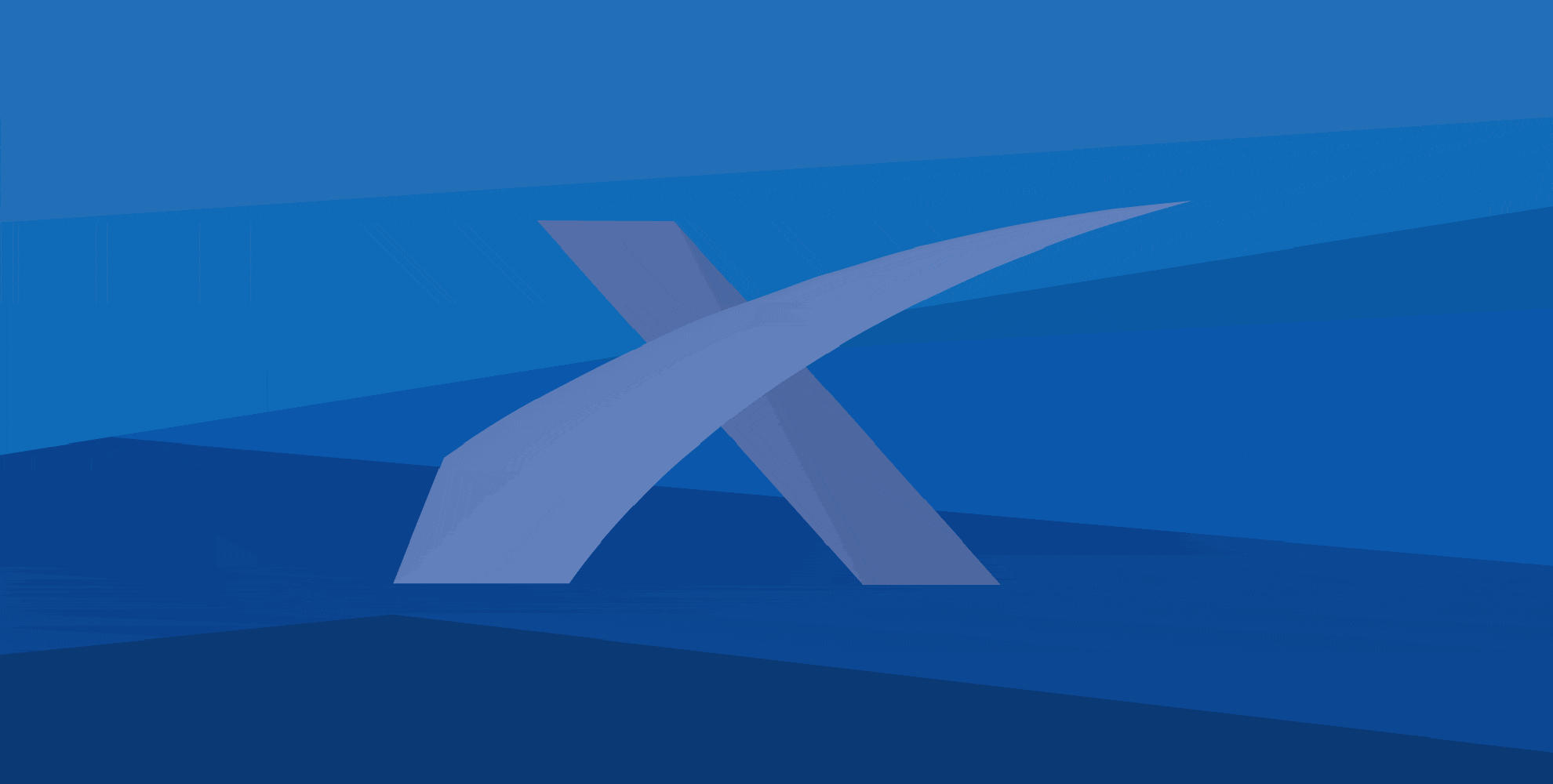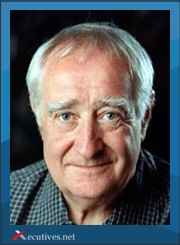
Fredi M. Murer
Fredi M. Murer, Jahrgang 1940, gehört zu den bekanntesten Schweizer Filmemachern. Mit Filmen wie ‚Wir Bergler in den Bergen‘ und ‚Höhenfeuer‘ erreichte er grosse internationale Anerkennung. Seine letzte und bekannteste Film-Produktion ‚Vitus‘, mit dem hochbegabten Teo Gheorghiu und Bruno Ganz in den Hauptrollen, verhalf ihm zu Weltruhm und brachte ihn in die Top-Liga der europäischen Filmschaffenden. 2007 wurde ihm für ‚Vitus‘ der Schweizer Filmpreis für den besten Schweizer Spielfilm verliehen. Fredi M. Murer gibt im Gespräch mit Christian Dueblin Auskunft über seinen Werdegang, über den Schweizer Film und über die Erfolgsfaktoren für seine diversen Produktionen.
Dueblin: Herr Murer, Sie spielen spätestens seit Ihrem Film ‚Höhenfeuer‘ und neuerdings auch mit ‚Vitus‘ in der internationalen Top-Filmemacher-Liga mit. Doch wenden wir uns zuerst Ihrer Frühzeit zu. Aufgewachsen sind Sie am Vierwaldstädtersee, umgeben von Bergen und in einem eher konservativen und damals noch sehr religiös geprägten Umfeld. Welches sind Ihre Erinnerungen an Ihre Jugendzeit?
Fredi M. Murer: Vorweg muss ich sagen, dass meine Kindheit auf dem Land bis heute meine ergiebigste Energiequelle geblieben ist. Ich bin 1940 in Beckenried am Vierwaldstädtersee in eine Grossfamilie hineingeboren worden. Meine Eltern hatten drei Buben und drei Mädchen, und ich bin von allen der Jüngste. Ich genoss alle Privilegien eines Nachzüglers und fühlte mich in meiner vorgefundenen ‚Sippe‘, in der es immer turbulent zu und her ging, sehr glücklich und geborgen. Auch meine Grossmutter, die altershalber bei uns wohnte, spielte eine zentrale Rolle in meinem Leben. Sie schrieb selber Gedichte, die teilweise veröffentlicht wurden. Sie las mir oft aus Büchern und Zeitungen vor. Beim Abwaschen sang sie Schubertlieder oder rezitierte Balladen. Als Belohnung für das Geschirr trocknen, durfte ich aus ihrer Geldbörse jeweils eine Münze auswählen. So lernte ich Geld zählen, bevor ich zur Schule ging.
Als ich noch im Kindesalter war, zügelten wir von Beckenried nach Altdorf im Kanton Uri, wo ich meine ganze Jugend- und Schulzeit verbrachte. Ich liebte die Schule nicht, weil sie mich auch nicht liebte. Denn alle meine Begabungen waren in der Schule nicht gefragt. So musste ich meine Interessen und meine Kreativität in der Freizeit ausleben. Die Schule habe ich zunehmend als Zeitverlust empfunden. Erschwerend kam hinzu, dass ich Linkshänder und Legastheniker war. Aber Nachteile haben ja immer auch Vorteile. Weil mir in der Schule die linke Hand auf den Rücken gebunden wurde, konnte ich danach mit beiden Händen Schreiben und Zeichnen. Als Legastheniker stand ich mit der Orthografie auf Kriegsfuss, was mich aber nicht daran hinderte, immer die längsten Aufsätze zu schreiben. Leider übersahen meine verzweifelten Lehrer vor lauter Fehler den Inhalt, was mich sehr unglücklich machte. Verzweifelt beschloss ich eines Tages, meinen nächsten Aufsatz nicht mehr zu schreiben, sondern zu zeichnen. Ich füllte mein Heft mit vielen rechteckigen Feldern und lieferte eine Bildergeschichte ohne Worte ab. Zurückblickend war dies eigentlich mein erster Film.
Als mit fünfzehn Jahren die Berufswahl ein Thema wurde, war es für mich unvorstellbar, lebenslänglich immer denselben Beruf ausüben zu müssen, und ich wünschte mir, möglichst viele Berufe erlernen zu können. Aber der Berufsberater hatte eine Liste mit den freien Lehrstellen in Uri und teilte uns einfach ein. In mir sah er den ‚geborenen Herrenschneider‘ und fügte an, sein Sohn habe gerade eine Lehrstelle frei. In diesem Augenblick wusste ich, dass ich von dort weg musste. Mein Vater wollte, dass ich Jurist werde und steckte mich in ein Internat. Dort fühlte ich mich tatsächlich interniert. Im Innersten wollte ich Künstler werden, aber das habe ich nie laut gesagt. Ich hatte auch keine Ahnung, wie man das wird. Das Wort ‚Kunst‘ hat mich schon als kleiner Junge immer magisch angezogen, weshalb ich wohl auch ins Kunstturnen ging. Immerhin brachte ich es in dieser Disziplin zum Innerschweizer Jungturner-Meister. Der damalige Trainer der Schweizer Nationalmannschaft, Jack Günthart, holte mich als grosse Nachwuchshoffnung nach Magglingen. Aber der paramilitärische Drill und die ewigen Achtungsstellungen nach jeder Übung waren nicht mein Ding. Ich lief in der Morgendämmerung davon und kehrte dem Sport für immer den Rücken.
Dueblin: Wie sind Sie Fotograf, Zeichner, Drehbuchautor und schliesslich Filmemacher geworden?
Fredi M. Murer: Aus dem Internat, in dem ich mich als Siebzehnjähriger auf mein Juristendasein hätte vorbereiten sollen, bin ich während der Fasnachtsferien nach Zürich abgehauen, um heimlich an der Kunstgewerbeschule die Aufnahmeprüfung zu machen. Der Test dauerte zu meinem Entsetzen drei Tage, was mich in grosse Verlegenheit brachte, weil ich zwei Mal im Hauptbahnhof-Wartsaal übernachten musste. Erst am dritten Tag rief ich meine älteste Schwester an, um wenigstens sie über meinen Ausflug nach Zürich zu informieren. Von ihr erfuhr ich, dass meine Eltern, das Schlimmste befürchtend, mich bei der Polizei als vermisst gemeldet hatten, was verständlicherweise in Uri, und vor allem in meiner Verwandtschaft, zu grosser Aufregung führte und mich in eine sehr missliche Lage brachte (lacht). Daraufhin ging ich nochmals zurück an die Schule und schilderte dem Direktor (Hans Fischli) meine prekäre Situation. Spontan schrieb er meinem Vater einen Brief und gab ihn mir verschlossen mit. Die Sache endete für mich gut. Nach der Lektüre des Briefes sagte mein Vater: ‚Also gut, lieber ein lebender Künstler als ein toter Jurist.‘ (lacht)

Fredi M. Murer
Dueblin: Und die Prüfungen in Zürich hatten Sie trotz dieser Aufregung bestanden?
Fredi M. Murer: Ja, ich bestand sie, aber vielleicht nur, weil der Direktor im Brief an meinen Vater dies vorausgesagt hatte. Jedenfalls übersiedelte ich nach dem Ende des Schuljahres nach Zürich. Nach dem absolvierten Vorkurs belegte ich das Fach ‚Wissenschaftliches Zeichnen‘. Gleichzeitig besuchte ich diverse Abendkurse und tagsüber schlich ich mich ab und zu in Vorlesungen an der Uni. Am Wochenende bediente ich im Zürcher Schauspielhaus einen der beiden Spot-Scheinwerfer auf dem Balkon und erlebte bei dieser Gelegenheit diverse Uraufführungen von Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch. Zürich war für mich ein absoluter Glücksfall. Ich sog alles in mich auf wie ein trockener Schwamm, der ins Wasser gefallen ist.
Dueblin: Wie kam es zur Liebe und zur Leidenschaft für den Film?
Fredi M. Murer: 1960 gab es im Kunstgewerbe-Museum eine Ausstellung zum Thema ‚Film‘. Bei dieser Gelegenheit wurden alle Klassiker der Filmgeschichte gezeigt, vom Stummfilm bis zu den aktuellen Autorenfilmen. In einem ganz bestimmten Stummfilm hat es mir, wie man so schön sagt, ‚den Ärmel reingenommen‘. Auf einen Schlag wusste ich, dass Film mein Medium ist. Alle meine Interessen wie Zeichnen, Sprache, Malerei, Musik, Schauspielerei, Dramaturgie, Architektur, Ethnologie und gesellschaftliche Fragen waren in dieser Kunstgattung gebündelt. Weil es damals noch keine Filmschulen gab in der Schweiz, wechselte ich an derselben Schule in die Fachklasse für Fotografie. Ich besorgte mir eine 16mm-Kamera und fing leidenschaftlich an, zu experimentieren und meine eigene Filmsprache zu erfinden und zu entwickeln. Damals, in den sechziger Jahren, herrschte in fast allen Bereichen der Kunst eine innovative Aufbruchstimmung. Jahr für Jahr besuchte ich die Tage der modernen Musik in Donaueschingen und das Experimentalfilm-Festival im belgischen Knokke-le-Zoute, wo ich mich inspirieren liess und viele Kontakte knüpfte. Zu meinem engsten Freundeskreis gehörten damals viele Kunstschaffende. Wir tauschten uns gegenseitig aus. Zu ihnen gehörte unter anderen auch der Maler H. R. Giger, mit dem ich 1969 den futuristischen Spielfilm ’swissmade – 2069′ drehte. Später habe ich über sein Leben und seine Werke einen Dokumentarfilm gedreht, ‚Passagen‘ (1971).
Dueblin: In Ihren Filmen ‚Höhenfeuer‘ und ‚Wir Bergler in den Bergen‘ setzen Sie sich, obwohl Sie Ihrer Heimat den Rücken zugekehrt hatten, mit Ihrer Herkunftsregion und Ihren Wurzeln auseinander. Diese scheinen Sie sehr geprägt und inspiriert zu haben?
Fredi M. Murer: Das schönste am Weggehen ist manchmal das Zurückkehren. ‚Wir Bergler in den Bergen‘ und ‚Höhenfeuer‘ sind zwei meiner wichtigsten Filme. Beide habe ich in Uri gedreht, aber nicht als Einheimischer, sondern eben als Rückkehrer, was mir zu einer Nähe aber auch zu einer Distanz verhalf. Das tut der Kunst immer gut. In beiden Filmen verarbeite ich natürlich auch eigene Erlebnisse und Erinnerungen aus meiner Jugend- und Schulzeit. Aber beim Dokumentarfilm ‚Wir Bergler in den Bergen‘ stand primär mein ethnologisches Interesse an der alpinen Kultur im Vordergrund. Meine Vorfahren väterlicherseits waren auch Bergbauern. Insofern war dieser Film für mich wie eine Reise zu meinen Ahnen und Urahnen.
‚Höhenfeuer‘ hingegen ist ein Spielfilm, der zwar auch im Bergbauern Milieu spielt, aber eine rein fiktive Geschichte erzählt, eine Art griechische Tragödie, die ich wegen der archaischen Schönheit der urnerischen Landschaft in dieser Region angesiedelt habe. Da ich auch das Drehbuch geschrieben habe, sind natürlich auch in diesem Film Erinnerungen an meine eigene Pubertätszeit eingeflossen. Insofern besteht zwischen dem gehörlosen Jungen im Film und mir, als ich fünfzehn war, wohl eine gewisse Seelenverwandtschaft. Eine mögliche Parallele besteht vielleicht darin, dass ich mich mit viel erfinderischer Phantasie, Mut und Eigensinn gegen die Einengung und Ausgrenzung durch die Schule zur Wehr setzte. Beim Jungen im Film ist es das Elternhaus anstelle der Schule.
Dueblin: Gab es in Ihrer Jugend Personen, die Ihr Potential erkannt und Sie gefördert hatten?
Fredi M. Murer: In unserer Grossfamilie herrschte generell ein sehr freiheitliches Klima. Aber meine Grossmutter war zweifelsohne meine wichtigste Muse. Sie hat mich ermutigt und inspiriert und hat mir gezeigt, dass es ausserhalb dieser engen Gebirgslandschaft, in der wir wohnten, noch andere Landschaften gab, auch geistige. Mein Grossvater war Zeichnungslehrer, mein Vater Erfinder, die Mutter schrieb Romane. Möglicherweise haben sie ihre genialen Gene alle mir vererbt (lacht). Als junger, ehrgeiziger und vielseitig interessierter Mensch brauchte ich zum Weiterkommen ein Klima, das mich indirekt förderte, indem ich gefordert wurde. Dieses Klima fand ich als Schulabgänger bei Josef Müller-Brockmann. Er übertrug mir, ich war 23, die Gesamtverantwortung für die fotografische Gestaltung des Pavillons ‚Schulwesen und Erziehung‘ an der Expo 1964 in Lausanne. Der Pavillon hat Max Bill entworfen, und das Atelier Müller-Brockmann war für die künstlerische Ausgestaltung zuständig. Dieser Auftrag bot mir als jungem Fotografen eine enorme Chance und interessante Herausforderung. Mit dem Geld, das ich damals verdiente, drehte ich später meinen ersten Film.
Dueblin: Was waren Ihre damaligen Visionen in Bezug auf Ihre Filme? Wollten Sie Spielfilme drehen? Welches Publikum wollten Sie erreichen?
Fredi M. Murer: Das kommerzielle Kino interessierte mich damals überhaupt nicht. Film war für mich ein künstlerisches Ausdrucksmittel. Mein Mekka war damals das Experimentalfilmfestival im belgischen Knokke-le-Zoute. Dort haben junge, verrückte und radikale Filmemacher und Filmemacherinnen aus aller Welt ihre filmischen Experimente und Gehversuche gezeigt. Es waren primär künstlerische Manifestationen und nicht Filme, die für ein breites Publikum bestimmt waren. Man begegnete dort auch dem jungen Godard, Polanski, Warhole oder Yoko Ono. Einmal zeigte sogar ich dort einen Film, ‚Chicorée‘. Meine experimentelle Phase war nicht Selbstzweck, sondern ich wollte meine eigene Filmsprache finden. Meine Vorbilder waren die grossen Meister des europäischen Autorenfilms, also Fellini, Bergman und Buñuel. Ein solcher Autorenfilmer wollte ich auch werden, aber davon war ich mit meinen 16mm-Filmchen noch weit entfernt. Mein Ziel war es, von meinen Filmen leben zu können, ohne Werbe- oder Auftragsfilme machen zu müssen. Der Start gelang. Ich hatte bereits mit meinen frühen eigenwilligen Produktionen Erfolg und gewann an kleinen Festivals immer wieder Preise. Dadurch konnte ich meine Filme europaweit an Fernsehstationen verkaufen. Mit der Zeit wurden meine Filme immer ein wenig länger, besser, teuerer, professioneller und offensichtlich auch universeller und damit publikumsfreundlicher.
Dueblin: Herr Murer, hier spricht nicht nur ein Künstler, sondern auch ein Unternehmer. Viele Künstler sind nicht fähig, sich durchzusetzen oder ein Geschäft zu führen. Es fehlt ihnen die unternehmerische Seite, die eben auch nötig ist, um erfolgreich zu sein. Für die Finanzierung von ‚Vitus‘ brauchten Sie rund fünf Jahre, ein Umstand, der zweifelsohne auch Ihren Durchhaltewillen aufzeigt. Wie haben Sie das gemacht?
Fredi M. Murer: Film ist generell ein sehr aufwändiges Medium. Darum ist immer ein Spagat zwischen Geld und Geist angesagt. Geld ist in diesem Sinne immer auch ein Stilmittel, d.h., die finanziellen Mittel beeinflussen die Arbeitsweise, die Ausstattung sowie die Besetzung entscheidend. Das bedeutet aber nicht, dass teure Filme automatisch auch die besseren Filme sind. Ich finde den Mix aus Kunst und Kommerz stimulierend und spannend. Ich habe darum auch keinerlei Berührungsängste gegenüber Geldfragen oder Geldgebern. Ich liebe es sogar, potentielle Investoren oder Sponsoren aufzuspüren und sie von meinen Projekten zu überzeugen. Als Gegenleistung kann ich ihnen allerdings höchstens einen ‚kulturellen Mehrwert‘ garantieren.
Dueblin: Sie sind nicht nur Regisseur, sondern zugleich auch Produzent.
Fredi M. Murer: Bei den meisten meiner Filme war ich auch Produzent oder zumindest Co-Produzent. Bei schwierig zu finanzierenden Projekten, wie beispielsweise ‚Der grüne Berg‘, es geht darin um die Entsorgung radioaktiver Abfälle, musste ich auch eigenes Geld investieren. Unabhängigkeit ist auch in der Schweiz nicht immer umsonst zu haben. Aber wie gesagt, diesen Spannungsbogen zwischen künstlerischer Arbeit und Kleinunternehmertum finde ich aufregend. Er behält einen auf dem Boden. Dabei kommt mir das Kopfrechnen zugute, in dem ich mich schon als Primarschüler hervorgetan hatte (lacht).

Szene aus dem Film „Vitus“
Dueblin: Nebst der Finanzierung der Filme gibt es auch andere Hindernisse, die ein Filmemacher überwinden muss. Welches sind nebst dem Geld die Herausforderungen, die Ihnen am meisten Arbeit und Einsatz abverlangen?
Fredi M. Murer: Als Filmemacher in der Schweiz ‚anständig‘ zu überleben ist schon deshalb schwierig, weil die Schweiz für eine kommerzielle Auswertung eines Films ein extrem kleines Land ist, das dazu noch in vier Sprachregionen aufgeteilt ist. Dazu kommen, wegen dem kleinen Markt, die hohen Produktionskosten. Das bedeutet, dass der einheimische Film ohne Subventionen oder öffentliche Filmförderung nicht überleben kann, wie übrigens auch unsere Theater-, Konzert- und Opernhäuser nicht. Das ist in ähnlich kleinen Ländern wie Dänemark, Holland, Schweden etc. nicht anders. In diesen Ländern werden auch Sprachen gesprochen, die ausserhalb der Landesgrenzen niemand versteht. In solchen Ländern ist man als Filmemacher von Anfang an zum ‚Lokalmattadorendasein‘ verurteilt. Natürlich gibt es Ausnahmen, welche die Regel bestätigen. Dennoch ist das einheimische Filmschaffen eine kulturell sehr wichtige Sache. Auf der Kinoleinwand vertraute Bilder zu sehen und sein eigenes Idiom zu hören, vermittelt den Bewohnern eines Landes einen Hauch von Identität und Identifikation.
Dueblin: Wie sehen Sie den Einfluss des Hollywoodfilms auf die Schweiz?
Fredi M. Murer: Die Kinobesucher in Amerika sehen fast ausschliesslich ‚Heimatfilme‘, also amerikanische Filme. Höchstens 3 – 4 % der Filme stammen aus anderen Ländern. Bei uns ist es praktisch umgekehrt. Nur in ein paar wenigen Städten mit hoher Kinodichte ist das Verhältnis USA und übrige Welt etwa 70 zu 30 %. So oder so werden unsere Hör- und Sehgewohnheiten vom amerikanischen Kino geprägt. Aber machen wir uns nichts vor, ohne Hollywood wären unsere Kinos vermutlich alle längst eingegangen. Die Kinobetreiber sind Unternehmer und als solche wollen sie in erster Linie Geld verdienen und nicht Filmkunst für eine verschwindende Minderheit anbieten.
Dueblin: Kann man als Schweizer Autor und Produzent vom Film leben?
Fredi M. Murer: Entweder ist man also ein raffinierter Fundraiser, so dass man vom Produktionsgeld leben kann, ohne dass der Film eine Kinoauswertung braucht. Oder es gelingt einem mit relativ kleinem Budget und viel Glück und noch mehr Können, einen herausragenden Film zu machen. Letzteres ist mir erstmals mit ‚Höhenfeuer‘ gelungen. Der Film gewann diverse internationale Preise und wurde in gut zwanzig Ländern im Kino gezeigt. Mein neuster Film ‚Vitus‘ hat in der Schweiz rund 280’000 Zuschauer ins Kino gelockt, und wir haben über 40’000 DVDs abgesetzt. ‚Vitus‘ hat aber auch die schweizer Grenzen überflogen. Er läuft in etwa sechzig Ländern, in halb Europa über Amerika und Australien bis Japan, Korea und China. Kürzlich hat mir ein Filmerkollege von ‚Vitus‘ eine DVD-Raubkopie aus Bali mitgebracht. Für einen Dollar hat er sie dort gekauft. Darauf bin ich natürlich stolz, denn normalerweise klauen sie nur amerikanische Blockbuster. Alles in allem bin ich auch ökonomisch ein Mensch mit Glückserfahrung.

Fabrizio Borsani, Fredi M. Murer und Bruno Ganz (v.l.n.r) bei den Dreharbeiten zum Film „Vitus“
Dueblin: Ist der Erfolg eines Filmes planbar und welchen Einfluss haben die Produktionskosten auf den Erfolg?
Fredi M. Murer: Leider, oder vielleicht auch eher zum Glück, ist der Erfolg eines Films nicht planbar. Sonst würde Hollywood garantiert nur noch erfolgreiche Filme herstellen. Auch Hollywood setzt auf zehn Filme mindestens sieben bis acht in den Sand, trotz hoher Budgets, grosser Staraufgebote und ebenso hoher Promotions-Budgets. Die Filmverleihfirma von ‚Vitus‘ hatte mir verboten, bei meinen Auftritten rund um die Welt, und ganz speziell in den USA, über das Budget von ‚Vitus‘ zu sprechen. Als ich sagte, dass der Film drei Millionen Dollar kostete, fragte man mich, ob das die Gage des Hauptdarstellers sei (lacht). Nur was teuer ist, wird von vielen Menschen als gut betrachtet. Umgekehrt heisst das für diese Menschen, dass das, was nicht teuer ist, auch nicht gut und qualitativ hochwertig sein kann. So sind die Wertvorstellungen ganz verschieden.
Dueblin: Was ist zu beachten, wenn Schweizer Filme exportiert werden sollen?
Fredi M. Murer: Die Filme, die wir hierzulande machen, sind klassische Nischenprodukte. Insofern ist die Filmmanufaktur Schweiz mit dem ‚Chäslädeli‘ neben dem Supermarkt zu vergleichen. Um unsere einheimischen Filme exportieren zu können, müssen wir universelle Geschichten erzählen, die aber gleichzeitig eine erkennbare Heimat haben. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ausserdem müssen wir logischerweise unsere Filme untertiteln oder Sprachversionen herstellen. Im benachbarten Deutschland leben zwar achtzig Millionen Leute, aber dort schaut sich niemand einen untertitelten Film an. Die Deutschen wollen nur deutsch synchronisierte Fassungen sehen. Das ist leider in immer mehr Ländern so. Durch die internationale Vermarktung wird ein Film im Übrigen automatisch zur Ware, was er ökonomisch und materiell gesehen ja auch ist. Da muss man als sensibler Filmemacher oft über den eigenen Schatten springen und zu gewissen Konzessionen bereit sein.
Dueblin: Die Sprache hat einen Einfluss darauf, ob ein Film erfolgreich ist oder nicht. Was ist diesbezüglich beim Drehen eines Filmes besonders zu beachten?
Fredi M. Murer: Die Glaubwürdigkeit eines Films hat entscheidend mit dem Ton zu tun, der in der Sprache der Schauspieler mitschwingt. ‚C’est le ton qui fait la musique.‘ Jede Sprache lebt von einer ganz spezifischen Musikalität. Viele Regisseure schenken diesem Umstand zu wenig Beachtung. Max Frisch hat einmal gesagt, wenn in einem Schweizer Film zwei Personen über die Zürcher Quaibrücke spazieren und miteinander Hochdeutsch sprechen würden, handle es sich um zwei Deutsche in Zürich. Damit wollte er sagen, dass Filme (im Unterschied zu Bühnenstücken) geografisch an identifizierbare Orte gebunden sind, und der Betrachter seine Kenntnisse über diesen Ort automatisch in seine Wahrnehmung einbezieht. Für Schweizer Ohren gibt es keinen glaubwürdigen Bergbauern mit Baslerdialekt. Im Fall von ‚Höhenfeuer‘, der in Uri spielt, mussten alle den gleichen örtlichen Dialekt sprechen. Wenn die Mutter bernern, der Vater baslern und die Tochter zürchern würde, so wäre die Glaubwürdigkeit der Geschichte empfindlich gestört. Ich lege deshalb grössten Wert auf die Sprache und wähle Schauspieler bewusst nach Dialekten aus. Das kostet sehr viel Zeit, und oft muss ich auf die Synchronisation zurückgreifen, damit meine Vorstellungen erfüllt werden. In ‚Vitus‘ habe ich die Mutter gewählt, weil sie Engländerin ist. Wenn sie emotional wird, spricht sie Englisch. Die Neurologin im Spital ist Deutsche, was häufig der Realität entspricht. Die Menschen im Kino sind dankbar, dass die Glaubwürdigkeit im Film intakt ist. Das Problem der Sprachbehandlung im Film ist in der Schweiz noch nicht gemeistert. Daran müssen wir noch arbeiten.
Dueblin: Liegt das nur an der Sprache der Schauspieler oder auch an schlechten Synchronisationen?
Fredi M. Murer: Eine schlechte Synchronisation kann einen Film inhaltlich und künstlerisch total zerstören. Eine gute Synchronisation kann hingegen ein Kunstwerk sein. Wie überall hat gute Arbeit ihren Preis, der von den für die Synchronisation verantwortlichen Verleihern oft nicht bezahlt wird.
Dueblin: Welches Publikum wollen Sie mit Ihren Filmen erreichen?
Fredi M. Murer: Ich habe den Ehrgeiz, ein möglichst breites Publikum mit einem sehr guten Produkt zu erreichen. Allerdings gibt es viele verschiedene ‚Publikums‘. Kinokassenfrauen sind die wichtigsten Informantinnen in Bezug auf Fragen rund um das Publikum. Zum Film ‚Vitus‘ seien viele Besucher gekommen, die sie noch nie im Kino gesehen hätten, Besucher vom Zürichberg und der Goldküste. Das zeigt mir, wen ich anspreche mit meinen Filmen. Mit ‚Vitus‘ konnte ich ein Publikum zu einem Kinobesuch motivieren, das sich aus allen Alters- und Gesellschaftsschichten zusammensetzte. Es darf aber nicht vergessen werden, dass dahinter sehr viel Promotionsarbeit steckt. Das ist eine sehr wichtige Arbeit. Die Leute gehen nicht einfach so ins Kino. Ich musste im In- und Ausland bei Radio- und Fernsehsendungen mitmachen, auch wenn mir das manchmal zuwider war. In den letzten Monaten habe ich an rund dreissig Open-Air-Kinoanlässen teilgenommen. Dieser Einsatz hat sich aber sehr gelohnt.

Teo Gheorgiou bei Dreharbeiten zu VITUS von Fredi M. Murer
Dueblin: Was ist das Erfolgsrezept von ‚Vitus‘? Wie erklären Sie sich diesen wunderbaren Erfolg für den Schweizer Film?
Fredi M. Murer: Für einen guten Film braucht es vor allem gute Schauspieler, aber natürlich auch ein gutes Drehbuch, gute Musik, ein gutes Team, vom Kameramann bis zur Kostümfrau, und nicht zuletzt einen guten Verleiher mit einem guten Marketingkonzept. All dies hatten wir bei ‚Vitus‘. Und der Regisseur hat seinen Job auch nicht allzu schlecht gemacht (lacht). Dazu kommt vielleicht das universelle Thema. ‚Vitus‘ ist eine Liebeserklärung an die Kindheit und an die Musik. Da die meisten Leute dazu neigen, ihre eigene Kindheit entweder zu verklären oder zu verdrängen, bietet mein Film eine Art Projektionsfläche an. Man kann sich in den Filmfiguren leicht wiedererkennen, entweder als verhindertes Genie oder als einsames oder missverstandenes Kind. Andere erkennen sich wieder in der liebenden und überforderten Mutter oder im kauzigen Grossvater. Insofern ist ‚Vitus‘ auch eine Hommage an die Kindheit jedes Zuschauers und jeder Zuschauerin. Damit meine ich jene wundersame Lebensphase zwischen 5 und 12 Jahren, also zwischen den ersten eigenen Erinnerungen und dem Beginn der Pubertät. Das ist für mich mit Abstand die spannendste, abenteuerlichste, aber auch fragilste Zeit im Leben eines Menschen. Ich habe mich beim Schreiben des Drehbuches von ‚Vitus‘ an meine eigene Kindheit erinnert. Wie Vitus war auch ich ein Traumwandler, irgendwo zwischen Wirklichkeit, Phantasie und Wunsch. In diesem Alter sind alle Kinder kleine da Vincis, Einsteins, Primaballerinas oder Weltraumpiloten. Ich beispielsweise überquerte mit zwölf den Ozean mit meinem Kon-Tiki-Floss. In Wirklichkeit war es der Urnersee. Weil ich Pianist sein wollte, band ich mein Akkordeon liegend auf ein Tischchen und meine Schwester musste den Balg bewegen. Oder ich baute die Flugmaschine von da Vinci nach und stürzte damit ab. Ein Schädelbruch war die Folge. Nach fünf Tagen wachte ich aus meiner Bewusstlosigkeit wieder auf. Wie Sie sehen hat ‚Vitus‘ durchaus autobiographische Züge, wenn auch zum Teil im spiegelverkehrten Sinne. Alle meine nicht in Erfüllung gegangenen Knabenträume habe ich mir durch diesen Film erfüllen können. Vitus ist der Prototyp eines Wunschkindes, mit dem sich alle Menschen irgendwie identifizieren können.
Dueblin: Die Schlussszene erinnert mich an Billy Elliot, den Tänzer, der am Ende dieses Films auf der Bühne grossen Erfolg hat, das heisst, seinen Traum erfüllen konnte, und sein Vater schaut dabei zu. Bei ‚Vitus‘ ist es das Konzert am Ende des Films. Sie wecken damit grosse Emotionen. Wie gelingt es einem Filmschaffenden, solche Emotionen hervorzurufen?
Fredi M. Murer: Das ist eine wunderbare Szene im Film ‚Billy Elliot‘ von Stephen Daldry. – ‚Film‘ ist Motion und Emotion. Für die Emotionen sind primär die Darsteller verantwortlich. Ich behaupte ja im Film, dass Vitus ein genialer Pianist ist. Also sagte ich mir, ich brauche ein real geniales Kind, das diese Rolle glaubhaft spielen kann. Ich hatte den Ehrgeiz, für die Rolle des Vitus einen Buben zu finden, der überdurchschnittlich Klavier spielt und gleichzeitig schauspielerisch begabt ist. Eigentlich zwei Buben, weil Vitus am Anfang des Films ja fünfjährig und danach zwölfjährig ist. Die Casting-Büros fanden, ich verlange Unmögliches. Also ging ich selber auf die Suche und fand in London, an einer Schule für musikalisch hochbegabte Kinder, meinen genialen Hauptdarsteller, Teo Gheorghiu. Alles stimmte bei ihm. Er war elf Jahre alt, spielte wunderbar Klavier, hatte schauspielerisches Talent und sprach sogar Schweizerdeutsch, nebst Rumänisch und Englisch. Der Drehbeginn war ein Jahr später, aber in der Zwischenzeit bekam er Schauspielunterricht, besuchte Meisterkurse und gewann nebenbei noch zwei internationale Klavierwettbewerbe. Basierend auf seinem reichen Repertoire stellten wir für den Film gemeinsam mit seinem Klavierlehrer, William Fong, und meinem Filmkomponisten, Mario Beretta, das Musikprogramm zusammen. Wir wählten bewusst auch Stücke aus, die Teo besonders liebte. Es war mir ein grosses Anliegen, Teo in möglichst alle Entscheidungsprozesse einzubeziehen, um so der Gefahr zu entgehen, ihn als Kind zu überfordern oder gar auszubeuten. Gegenüber Kinderdarstellern trägt man als Regisseur eine grosse Verantwortung. Rückblickend erweist sich der Film für alle Beteiligten als Glücksfall. Für Teo diente er als Startrampe für seine pianistische Karriere. ‚Fliegen‘ muss er aus eigner Kraft, und er tut das vorbildlich. Inzwischen hatte er ein gutes Dutzend Auftritte nur in der Zürcher Tonhalle, aber auch in vielen andern Konzerthäusern im In- und Ausland. Eben hat er in Istanbul und in St Petersburg Konzerte gegeben, und im Herbst ist er nach Japan eingeladen, wo er mit dem Tokyo Philharmony-Orchestra in der Suntory Hall spielen wird. Wenn ich mir all das vor Augen führe, erwacht in mir ein grosses Glücksgefühl. Mit Teo Gheorghiu und Fabrizio Borsani, als fünfjährigem Vitus, habe ich zwei authentisch hochbegabte Buben gefunden, die dem fiktiven Film eine fast dokumentarische Glaubwürdigkeit verleihen. Das ist ein wesentlicher Grund für den grossen Erfolg des Films. Natürlich haben auch Bruno Ganz, Julika Jenkins und alle andern Darsteller zum Erfolg viel beigetragen.
Dueblin: Sehr geehrter Herr Murer, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen bei all Ihren Projekten weiterhin viel Erfolg! Wir sind gespannt auf Ihre nächste Filmproduktion!
(C) 2008 by Christian Dueblin. Alle Rechte vorbehalten. Anderweitige Publikationen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors gestattet. Publikation der Fotos mit freundlicher Genehmigung von Fredi M. Murer.
_________________________
Links:
– Homepage von Mario Beretta
– Portrait Teo Gheorghiu
– Alles zum Film ‚Vitus‘
– Wikipedia