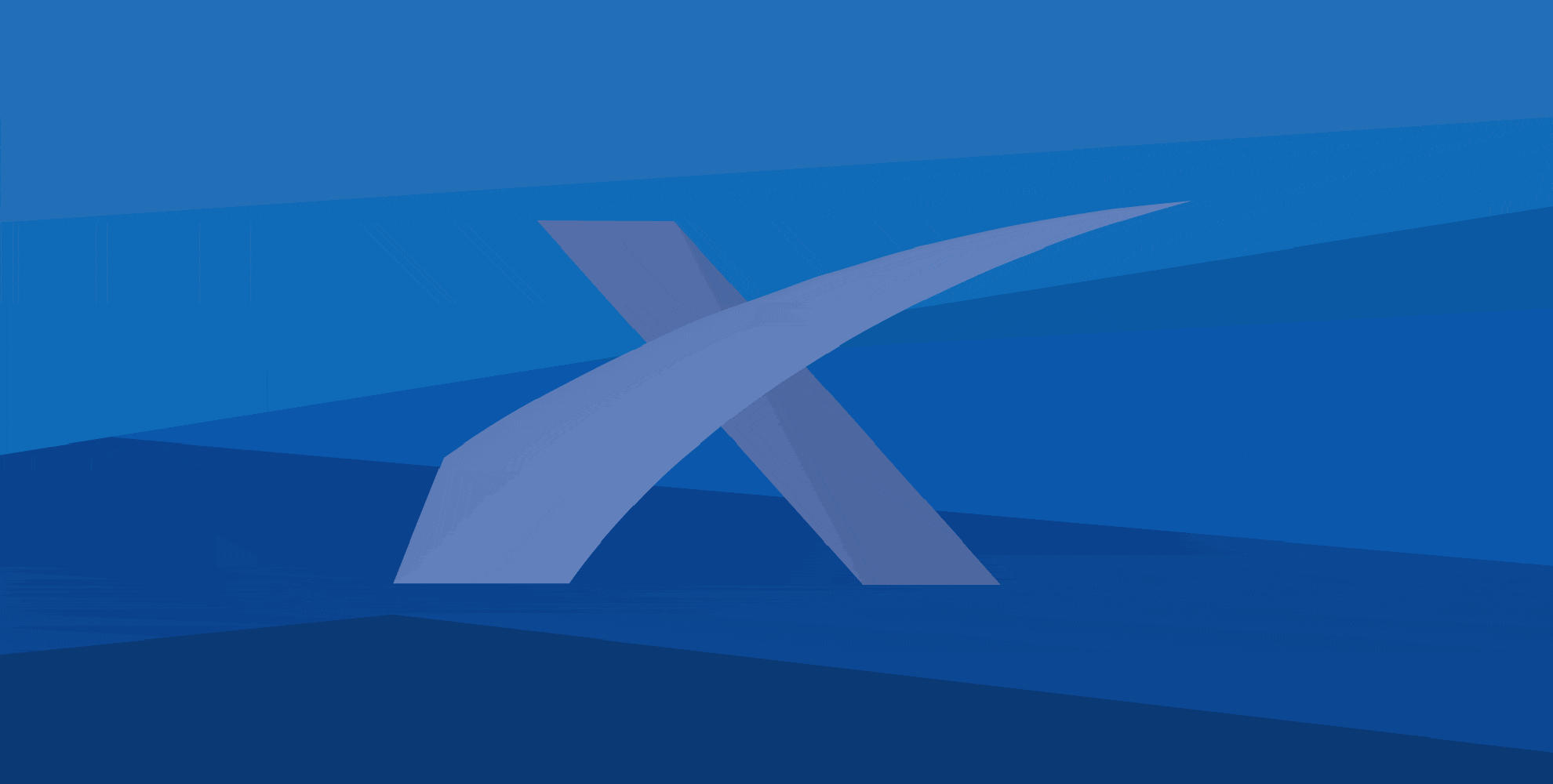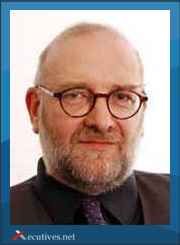
Manfred Papst
Manfred Papst, 1956 in Davos geboren, studierte in Zürich Sinologie, Germanistik, Kunstgeschichte und Geschichte. Nach Stationen als Lehrer, Lektor und Herausgeber in Verlagen wurde er im Jahre 1989 Programmleiter des NZZ Buchverlages. Seit 2002 leitet Manfred Papst das Ressort Kultur der „NZZ am Sonntag“. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er mit seinen geistreichen und pointierten Kolumnen „Zugabe“ in der „NZZ am Sonntag“ bekannt. Manfred Papst gehört zu den bekanntesten Literatur- und Kulturkritikern in der Schweiz. Im Jahr 2005 wurde er in der Kategorie Alltagsjournalismus mit dem Zürcher Journalistenpreis für seine journalistischen Leistungen ausgezeichnet. Im Gespräch mit Christian Dueblin erzählt er von seinem Werdegang, spricht über die Entwicklungen in der Kunst und zeigt auf, was Krisen und Notlagen für Auswirkungen auf die Entwicklung von Kunst und Kultur haben.
Dueblin: Sie sind bekannt als Leiter des Ressorts Kultur der „NZZ am Sonntag“ und als versierter Kolumnist mit grosser Fan-Gemeinde. Ich zähle mich ebenfalls dazu. Ihr Betätigungsfeld reicht von klassischer Musik bis zu Pop und Rock und Jazz, aber auch von gehobener Literatur bis hin zur Auseinandersetzung mit Kommerz. Während Ihrer Studienzeit haben Sie auch Sinologie studiert und sich mit der chinesischen Kultur und Sprache intensiv auseinandergesetzt. Was waren Ihre Beweggründe, dieses Fach zu wählen?
Manfred Papst: Ich muss etwas ausholen. Ich bin in Davos aufgewachsen und ging dort in die Primar- und Mittelschule. Gegen Schluss meiner Gymnasialzeit kam ein neuer Schüler in unsere Klasse. Er war ein sogenannter „Interner“, das heisst, er wohnte auch im Internat. Ich wohnte bei meinen Eltern und galt deshalb als „Externer“. Sein Name war Paul Kramers. Wir sind Freunde geworden. Er war der Sohn von Robert Paul Kramers, dem damaligen Ordinarius für Sinologie an der Universität Zürich. Aufgrund meines Interesses für Bücher etwa von Hermann Hesse war ich schon ein bisschen „chinainfiziert“. Durch die Bekanntschaft mit Pauls Vater fing ich dann Feuer für dieses Fach und wollte es studieren.
Eigentlich hatte ich vorgehabt, Germanistik zu studieren. In der ganzen Anmassung eines Achtzehnjährigen dachte ich jedoch, dass man Germanistik auch nebenbei studieren könne. Ich wählte also als Hauptfach Sinologie und besetzte Germanistik und Kunstgeschichte im Nebenfach, später studierte ich noch Geschichte als zweites Hauptfach. Nach drei Jahren modernem Chinesisch studierte ich schliesslich das klassische Chinesisch, das mich besonders interessierte. Es war weniger die moderne Kultur Chinas als die klassische chinesische Philosophie und Lyrik, die mich faszinierten. Ich bin kurioserweise nie in China gewesen. Wir befanden uns damals in den Siebzigerjahren, in der letzten Phase von Mao. Man konnte zu dieser Zeit in China nicht frei reisen. Es wäre zwar möglich gewesen, in China eine Sprachschule zu besuchen, was mir aber nicht sehr zusagte. Der Hauptgrund, warum ich schliesslich nicht nach China ging, war jedoch die Tatsache, dass ich damals meine spätere Frau kennenlernte. Der Entscheid für sie und gegen ein Studium nach China war richtig. Wir sind inzwischen über dreissig Jahre verheiratet.
Ich habe also mit Leidenschaft Sinologie studiert und daneben Germanistik und Kunstgeschichte in den Nebenfächern abgeschlossen. Schon während des Studiums habe ich als Lehrer gearbeitet und war für Verlage tätig. Die zweite Hälfte meines Studiums konnte ich mir bereits selber verdienen. Besonders die Verlagsszene bot mir damals vielfältige berufliche Perspektiven. Zwar gab es an den Universitäten in Zürich und Genf sinologische Abteilungen. Die beruflichen Optionen waren aber begrenzt. Darum verfolgte ich die Sinologie damals beruflich nicht mehr weiter.
Dueblin: Gibt es Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Sinologie, die Sie heute als Kulturexperte beschäftigen oder sich prägend auf Ihre Arbeit als Journalist auswirken?
Manfred Papst: Die chinesische Kultur interessiert mich nach wie vor, vor allem die Literatur und die Philosophie. Ich lese auch heute noch viel darüber. Ich verfolge, was übersetzt wird, und schreibe hin und wieder über chinesische Themen. Ich habe die klassische Literatur aus meiner Studienzeit in den Originaltexten behalten. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich diese Texte flüssig lesen könnte. Aber ich kann mich mit Hilfe meiner damaligen Notizen durch sie hindurchbuchstabieren. Es ist aber wie mit dem Klavierspielen. Man muss über die Jahre hinweg dran bleiben und üben. Bei mir liegt das Lizentiat ein Vierteljahrhundert zurück. Ich habe also auch viel vergessen. Die Erinnerung kommt aber bei der Lektüre zurück. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, mich nach meiner Pensionierung noch einmal vertieft mit chinesischen Texten auseinanderzusetzen.
Ich bedaure keine Sekunde, dass ich das Studium der Sinologie gewählt habe. Es hat mir Zugang zu einer Sprache vermittelt, die völlig anders aufgebaut ist als unsere Sprachen in Europa. Es gibt in der chinesischen Sprache ein paar Stellungsgesetze und Partikel. Es gibt aber keine Deklination und keine Konjugation. Die Sprache erscheint uns deshalb wenig strukturiert. Die Chinesen würden umgekehrt behaupten, unsere Sprache sei überdefiniert. Wilhelm von Humboldt hat sich intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Er sprach wohl etwa 35 Sprachen und vertrat die dezidierte Meinung, dass der Stand einer Kultur sich immer auch in der Komplexität der Sprache ausdrücke und sich in der Differenziertheit der Grammatik spiegle. Für ihn war das Chinesische ein grosses Problem, denn es passte irgendwie nicht in sein Konzept. China war zweifelsohne eine Hochkultur, trotz seiner wenig strukturierten Sprache.
Dueblin: Sie haben vor vielen Jahren über Iggy Pop einen Kommentar in der „NZZ am Sonntag“ geschrieben, der mich faszinierte. Ich empfand diesen Text als sehr informativ und enorm lustig. Seither verfolge ich Ihre Kolumnen und Texte und stelle immer wieder fest, wie vielseitig Sie informieren und tätig sind. Man spürt, dass Sie sehr hohe Ansprüche an die Sprache und die qualitative Beschaffenheit dessen stellen, was man Ihnen vorlegt und worüber Sie schreiben. Woher stammt dieses ausgeprägte Anspruchs- und Qualitätsdenken?
Manfred Papst: Mir bereiten gute Sachen mehr Freude als nicht so gute. Kultur ist in diesem Sinne etwas sehr Demokratisches. Wir würden vielleicht alle gerne in einem Schloss mit Seeanstoss wohnen oder regelmässig im besten Restaurant von Zürich essen, aber wir können es uns nicht leisten. Auch finden wir einen Rolls Royce ein schönes und edles Auto, fahren aber aus Kostengründen ein weniger exquisites. In der Kultur verhält es sich etwas anders, denn jeder kann sich das Beste leisten. Das Beste ist nicht teurer oder schwerer zu ergattern als etwas Mittelmässiges oder etwas Schlechtes. Warum also soll ich mich mit etwas Mittelmässigem zufrieden geben, wenn ich den Zugang zu der ganzen Fülle von qualitativ hochstehenden Dingen habe? Wenn ich zwischen einem Buch von Johannes Mario Simmel und einem solchen von James Joyce wählen kann, dann wähle ich Letzteren – beide sind in etwa gleich teuer.
Dueblin: Welches sind die Kriterien, nach denen Sie ein gutes (Kunst-)Werk von einem schlechten unterscheiden?
Manfred Papst: Das ist immer sehr persönlich und hängt vom eigenen Geschmack ab. Man kann den Geschmack aber schulen. So wie es Weinkenner gibt, die über die Jahre Erfahrungen gesammelt haben und die Qualität eines Weines erkennen, steht es auch mit der Literatur oder der Musik. Man merkt in der Auseinandersetzung mit diesen Themen, dass es Werke gibt, die von ihrer Emotionalität und ihrer intellektuellen Struktur her mehr hergeben und vermitteln, als es andere Werke tun. Für mich ist ein wichtiges Kriterium, ob etwas, mit dem ich mich befasse, Leben hat und atmet. Ein Buch oder ein Musikstück muss mir etwas vermitteln und mir helfen, die Welt besser zu verstehen und zu erfahren. Ich kann beim Lesen in verschiedenste Häute schlüpfen. Ich lese ein Buch und fahre in meiner Phantasie in die Südsee oder besteige den Mount Everest. Gute Literatur eröffnet mir somit Welten, die ich erfahren und in denen ich leben kann.
Dueblin: Sie setzen sich immer wieder sehr intensiv mit Jazz-Musik auseinander, einer Musik- und Kunstrichtung, die Sie ebenfalls zu faszinieren scheint. Was reizt Sie am Jazz?
Manfred Papst: Wenn ich das in einem Wort zusammenfassen müsste, würde ich den Titel eines Buches des von mir sehr verehrten Whitney Balliett wählen, einem grossen Jazz-Kenner und Autor, nämlich „The Sound of Surprise“. Es ist die Überraschung, die Lebendigkeit und die Improvisation, die mich am Jazz anziehen. Jazz ist eine Musikrichtung, die meines Erachtens mehr als andere aus dem Moment schöpfen kann. Jazz ist nichts Reproduziertes. Die Interpretation klassischer Musik ist ebenfalls eine sehr anspruchsvolle Sache. Auch in der klassischen Musik wird immer wieder neu interpretiert. Der Jazz geht aber meiner Wahrnehmung nach einen Schritt weiter. Der spontane und kreative Akt steht dabei im Zentrum.
Die Auseinandersetzung vor allem mit dem modernen Jazz hat mit meinem Beruf als Kritiker zu tun. Man begleitet die Gegenwart. Ich beschäftige mich als Journalist mit Dingen, die neu erscheinen und mit Menschen, die heute auftreten. Der moderne Jazz ist aber nicht meine grösste Liebe. Es sind mehr die Vierziger-, Fünfziger- und Sechzigerjahre des Jazz, die mich persönlich begeistern.
Dueblin: Ich habe in meinem Leben einige sehr gute Jazz-Musiker kennengelernt und gefragt, warum der Jazz in der Musikwelt eine Nischenfunktion einnimmt. Dem Jazz gelang nie ein Durchbruch wie beispielsweise der Pop- oder Rock-Musik. Dick Hyman, Woody Allens Pianist, meinte im Interview mit Xecutives.net., dass diese Frage sehr schwer zu beantworten sei. Joe Turner war der Meinung, dass Jazz etwas sehr Persönliches sei und nur im kleinen Rahmen gespielt Sinn und Spass mache. Henri Chaix meinte, die Musik sei möglicherweise für viele Menschen zu intellektuell und zu anspruchsvoll. Wie würden Sie diese Frage beantworten?
Manfred Papst: In den Zwanziger-, Dreissiger- und bis zu den Vierzigerjahren war der Jazz das, was heute der Pop und der Rock sind. Jazz war Musik, die man in Clubs hörte und zu der man oft auch tanzte. Erst der Rock ’n’ Roll und der Soul haben den Jazz in die Nische gedrängt, die er bis heute besetzt. Das Nischendasein des Jazz hängt auch damit zusammen, dass die neuen Musikstile mit massiveren und stärkeren Reizen arbeiten und dadurch ein grösseres Publikum erreichen.
Dem Jazz warf man auch immer wieder vor, eine intellektuelle Bewegung zu sein. Das trifft aber meines Erachtens nur bedingt zu, denn es gibt auch im Jazz ganz verschiedene Stilrichtungen. Der Dixieland, dem man oft nachsagt, „Bierhallen-Jazz“ zu sein, ist keine intellektuelle Musik. Wenn ein Keith Jarrett auftritt, ist das schon wieder eher der Fall, und trotzdem sind seine Konzerte immer ausverkauft. Er spielt nur an sehr bekannten Orten, etwa in der Frankfurter Oper, der Scala in Mailand oder beispielsweise im Stravinsky Auditorium in Montreux. Jazz ist aber nicht stadionkompatibel und für grosse Menschenmassen ungeeignet. Die Musikformate haben sich im Verlaufe der Zeit sehr geändert. Sie richten sich an immer mehr Menschen und brauchen dazu auch grössere Bühnen. Eignet sich eine Musik nicht für diese Bühnen, kann sie auch nicht so viele Menschen erreichen.
Dueblin: Viele Plattenfirmen haben grossen Einfluss darauf, was auf den Markt kommt. Hat eine Zeitung wie die „NZZ am Sonntag“ ebenfalls Einfluss darauf, wo unsere Kultur und damit auch die Kunst und die Musik hingehen?
Manfred Papst: Ich glaube, in der Popmusik haben Zeitungen nur in geringem Mass einen solchen Einfluss. In der Literatur verhält es sich etwas anders. Wenn beispielsweise der neue Roman von Lukas Bärfuss in den Zeitungen gepriesen wird, dann hat das auf den Verkauf des Buches einen Einfluss. Es gibt aber eine Vielzahl von Werken der Populärkultur, die an der Kritik vorbeilaufen. Was wir über den Bestseller-Autor Paulo Coelho schreiben, hat keinen Einfluss darauf, ob er viele oder wenige Bücher verkauft. Die Menschen, die seine Bücher lesen, wollen die Mischung aus Unterhaltung und Lebenshilfe haben, die er anbietet. Man könnte hier von einem Pakt der breiten Leserschaft sprechen. Noch extremer verhält es sich beim Film. Grossproduktionen spielen oft am ersten Wochenende schon ihre Produktionskosten ein. Es spielt dabei in der Regel gar keine Rolle, was die Kritik schreibt. Bis die Kritik ins Bewusstsein der Leser eingedrungen ist, ist das Geschäft eigentlich schon gemacht.
Dass Plattenfirmen oft den Sound bestimmen, kann in Bezug auf die Qualität schlecht sein, muss aber nicht. Das Label „Motown“ aus Detroit feierte eben seinen fünfzigsten Geburtstag. Berry Gordy Jr., der das Label über Jahrzehnte leitete, hatte seine grosse Zeit von 1960 bis Ende der Achtzigerjahre. Er hatte Komponisten, Bands und Arrangeure angestellt. Auch sehr bekannte Solisten haben nach seiner Pfeife getanzt. Darunter finden wir Künstler wie Diane Ross, Michael Jackson oder Stevie Wonder, also Super-Stars. Gordy gab diesen Musikern mit einem grossen Sinn für das Geschäft und den Erfolg vor, welche Lieder sie zu interpretieren hatten. Die Produkte dieser Künstler waren also oft nicht ihre eigenen Ideen. Sie waren in einem gewissen Sinne Angestellte und produzierten das, was Gordy von ihnen haben wollte. Mit diesem Vorgehen schaffte es „Motown“, rund 200 Nummer 1-Hits zu landen. Jazz hat ebenfalls oft so funktioniert. Musiker gingen jeden Tag zur Arbeit und spielten ihr Instrument so, wie es ein berühmter Band-Leader haben wollte. Die Musiker selber hatten oft nur eine Begleitfunktion. Wie wir wissen, sind die Resultate einiger dieser Bands hervorragend. Die Vorgaben und Ideen von einzelnen Menschen oder von ganzen Plattenfirmen müssen somit nicht schlecht sein. Oft sind sie es aber. Das passiert in der Regel dann, wenn die Produzenten ihre Künstler für Projekte einsetzen, für die sie nicht gemacht sind und die sie im Grunde genommen auch nicht mögen.
Dueblin: Wir sind von einer Wirtschaftskrise betroffen, die uns noch länger beschäftigen wird. Sie haben vor einiger Zeit über einen Schweizer namens Fritz Schwarz geschrieben, einen Lehrer, der in den Zwanzigerjahren ein Buch mit dem Titel „Segen und Fluch des Geldes in der Geschichte der Völker“ geschrieben hat. Das Buch erschien nur wenige Jahre vor der damaligen Weltwirtschaftskrise. Wie kam es zur Auseinandersetzung mit Fritz Schwarz und seinem Buch, dessen Titel heute nicht aktueller sein könnte?
Manfred Papst: Das hat einen ganz persönlichen Grund. Fritz Schwarz hat eine Tochter. Sie heisst Ruth Binde. Sie ist seit Jahrzehnten im Buch-Geschäft und eine der rührigsten Literaturpromotorinnen in der Schweiz. Sie war Pressechefin in Verlagen und hat sich unermüdlich und mit ungebrochener Energie für die Literatur eingesetzt. Sie ist auch die Prophetin des Werkes ihres Vaters. Ich schätze sie sehr und habe mich nach Gesprächen mit ihr aus reiner Neugier mit den Büchern ihres Vaters beschäftigt. Ich bin kein Ökonom und kann auch nicht sagen, ob seine Konzepte wirklich durchführbar wären und realistisch sind. Eine Idee hat mich aber sehr fasziniert. Schwarz sagt, der Boden gehöre allen Menschen, so wie auch die Luft allen Menschen gehöre. Er wollte damals verhindern, dass der Boden noch mehr zum Spekulationsobjekt wurde. Das war schon damals ein grosses Thema und eine Herausforderung. Der Boden sollte seines Erachtens dem Staat gehören und den Menschen zu festen Zinsen verpachtet werden. Vielleicht ist das weltfremd. Ich betrachte es aber als originelle Idee. Der Titel des Buches könnte heute wirklich nicht aktueller sein.
Dueblin: Gibt es Ihres Erachtens schon erste Hinweise am Horizont, wie sich die derzeitige Krise auf die Kultur auswirken könnte?
Manfred Papst: Man muss einen qualitativen und einen quantitativen Aspekt unterscheiden. Die Kulturindustrie verhält sich oft antizyklisch zur Wirtschaftslage. Schlechte Zeiten sind für die Kultur gute Zeiten. Man kann es ganz verkürzt ausdrücken und Groucho Marx zitieren. Er sagte: „Bad days are good memories.“ Über schlechte Zeiten lässt sich mehr erzählen als über gute Zeiten. Wir können beobachten, dass schwierige Zeiten sehr gute Literatur und Kunst hervorbringen. Das ist der qualitative Aspekt. Ich glaube also nicht, dass die Krise in der Kultur zu einem qualitativen Einbruch führen wird.
Anders sieht es auf der quantitativen Seite aus. Der Kunstmarkt ist in weiten Teilen zusammengebrochen. Die Zahlen der grossen Auktionshäuser sind katastrophal. Die Verkäufe in den Galerien sind schlecht, einmal abgesehen von einzelnen Ausnahmen. Auch die Musikindustrie leidet und spürt die Krise. Die CD-Verkäufe gehen zurück. Das hängt aber nicht nur mit der Krise zusammen. Es macht sich schon seit einiger Zeit ein Strukturwandel bemerkbar. Die jungen Leute bedienen sich zunehmend im Internet und laden dort die Musik herunter, die ihnen gefällt – legal oder illegal. Es werden somit weniger Tonträger verkauft. Das hat Auswirkungen auf die Werke selber. Alben, die lange das bevorzugte Format waren und mit denen man Musik vermittelte, verlieren immer mehr an Bedeutung. Der einzelne Song hingegen gewinnt beim Publikum an Bedeutung. Das sind wesentliche Veränderungen auf dem Musikmarkt.
In der Literatur sieht es in quantitativer Hinsicht anders aus. Schlechte Zeiten in der Wirtschaft sind gute Zeiten für Bücher, da die Menschen mehr lesen. Das Lesen ist ein preiswerter Zeitvertreib, und die Gesellschaft macht sich in Krisenzeiten mehr Gedanken über das Leben und die Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Die Kultur geht also nicht unbedingt im Gleichschritt mit der Krise.
Überall dort, wo die Kultur von der Wirtschaft lebt, hat eine Wirtschaftskrise aber auf jeden Fall massive Auswirkungen. Ein grosser Teil der Kultur ist finanziell von der öffentlichen oder privaten Hand abhängig. Wenn Banken miserabel arbeiten und grosse Verluste ausweisen, können beispielsweise weniger Festivals oder Opernhäuser gesponsert werden. Das ist in den USA, wo kulturelle Institutionen noch viel mehr von privaten Geldgebern abhängig sind, viel extremer als hier in Europa und insbesondere in der Schweiz. Das volle Ausmass der Krise auf die Kultur ist deshalb noch nicht wirklich ersichtlich, denn die Gelder für das Jahr 2009 sind schon vor längerer Zeit gesprochen worden. Würden diese Gelder in nächster Zeit gestrichen werden, dann hätte das aber bestimmt massive Auswirkungen auf das Kulturleben auch hier in der Schweiz.
Dueblin: Könnte es sein, dass eines Tages auch die Kultur einbricht, wie das bei vielen Unternehmen, aber auch bei ganzen Ländern zurzeit zu beobachten ist? Halten Sie es für möglich, dass sich die Kultur oder die Kunst selber als bankrott erklären muss?
Manfred Papst: Es gibt interessante Beispiele, die wohl in diese Richtung gehen. Denken Sie an den Dadaismus, damals eine Reaktion auf den Ersten Weltkrieg. Der Dadaismus wollte nach all den sinnlosen Zerstörungen des Ersten Weltkrieges aufzeigen, dass die Werte vernichtet waren. Der Dadaismus hat auf den verlogenen Heroismus und Patriotismus reagiert, der zum Ersten Weltkrieg geführt hatte. Er wollte mit einer Kunst, die jeden Sinn negiert, zum Denken anregen. Er wollte zeigen, dass die Welt absurd, verrückt und unbegreiflich ist. Die vorerst faszinierende Bewegung blieb aber irgendwann stecken und wurde sehr infantil. Sie lief sich zu Tode. Kurz nach dieser Epoche entstand die grösste Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts. Denken Sie an James Joyce und seinen „Ulysses“ oder an Thomas Mann und seinen „Zauberberg“. Das sind Bücher der Zwanzigerjahre, die kurz nach dem Krieg erschienen. Es zeigte sich damals ein neuer Gestaltungs- und Formwille. Es reichte nicht, sich auf eine regredierende Position zurückzuziehen, wie das der Dadaismus getan hatte. Kultur besteht immer aus Kraft und Gegenkraft. So gab es beispielsweise in der 1970er Jahren den Glitter- und Glamour-Rock. Darauf folgte der Punk, ein Musikstil, der hart, aggressiv, so primitiv wie möglich und mit drei Griffen auf der Gitarre spielbar war. Aus der heutigen Distanz betrachtet ist die Punk-Musik, beispielsweise der „Sex Pistols“, schon fast wieder nett. Damals aber war sie skandalös.
Solche Reaktionen gab es immer wieder in der Geschichte der Kunst. Ich glaube, dass sich die Kunst in Wellen bewegt. Ich meine nicht in berechenbaren Wellen, wie sie Francesco Kneschaurek für die Konjunktur postuliert hat. Es gibt in der Kunst Blütezeiten und Zeiten der Öde. Das sieht man oft erst im Nachhinein. In diesem Jahrzehnt ist meines Erachtens beispielsweise in der bildenden Kunst nicht sehr viel Neues passiert. Dafür gab es bemerkenswerte Innovationen in der Musik.
Dass eine Kultur völlig zusammenbrechen kann, glaube ich aber nicht. Kultur ist ein anthropologisches Universale, um es ein bisschen hochgestochen auszudrücken. Ein Lied singen oder eine Geschichte erzählen und ein Bild malen, das gehört zum Ureigensten des Menschen. Das hat er in allen Epochen gemacht. Die Themen, die der Mensch behandelt, sind sehr konstant. Marcel Reich-Ranicki sagte einmal, die Literatur habe nur zwei Themen, nämlich die Liebe und den Tod. Ich würde ihm zustimmen, was die wesentlichen Werke der Weltliteratur betrifft. Diese beiden Hauptthemen sind konjunkturunabhängig.
Dueblin: Kann man feststellen, dass eine Krise, wie wir sie heute haben, neue Kunstformen hervorbringt, die Gegenkräfte zum heutigen Wirtschaftleben darstellen?
Manfred Papst: Man kann sich eine neue Kunstform in der Regel erst vorstellen, wenn sie da ist. Man sieht das in den verschiedenen Epochen immer wieder. Stets waren die Menschen im Verlaufe der Zeit der Meinung, man habe die Kunst ausgeschöpft und könne nichts mehr Neues machen. Plötzlich aber kommt wieder jemand und bringt etwas Neues hervor. Meines Erachtens handelt es sich bei der gegenwärtigen Finanzkrise um eine schlimme und ernste Krise. Sie bedeutet aber nicht den Weltuntergang. Ich bin zuversichtlich und glaube daran, dass wir sie überwinden werden. Jetzt, wo wir mitten drin stecken, sind wir vielleicht nicht immer so optimistisch. Aus der Distanz, also in einigen Jahrzehnten, wird das aber wieder anders aussehen.
Dueblin: Sehr geehrter Herr Papst, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen und dem Ressort Kultur der „NZZ am Sonntag“ weiterhin alles Gute.
(C) 2009 by Christian Dueblin. Alle Rechte vorbehalten. Anderweitige Publikationen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors gestattet.
______________________________
Links
– NZZ am Sonntag