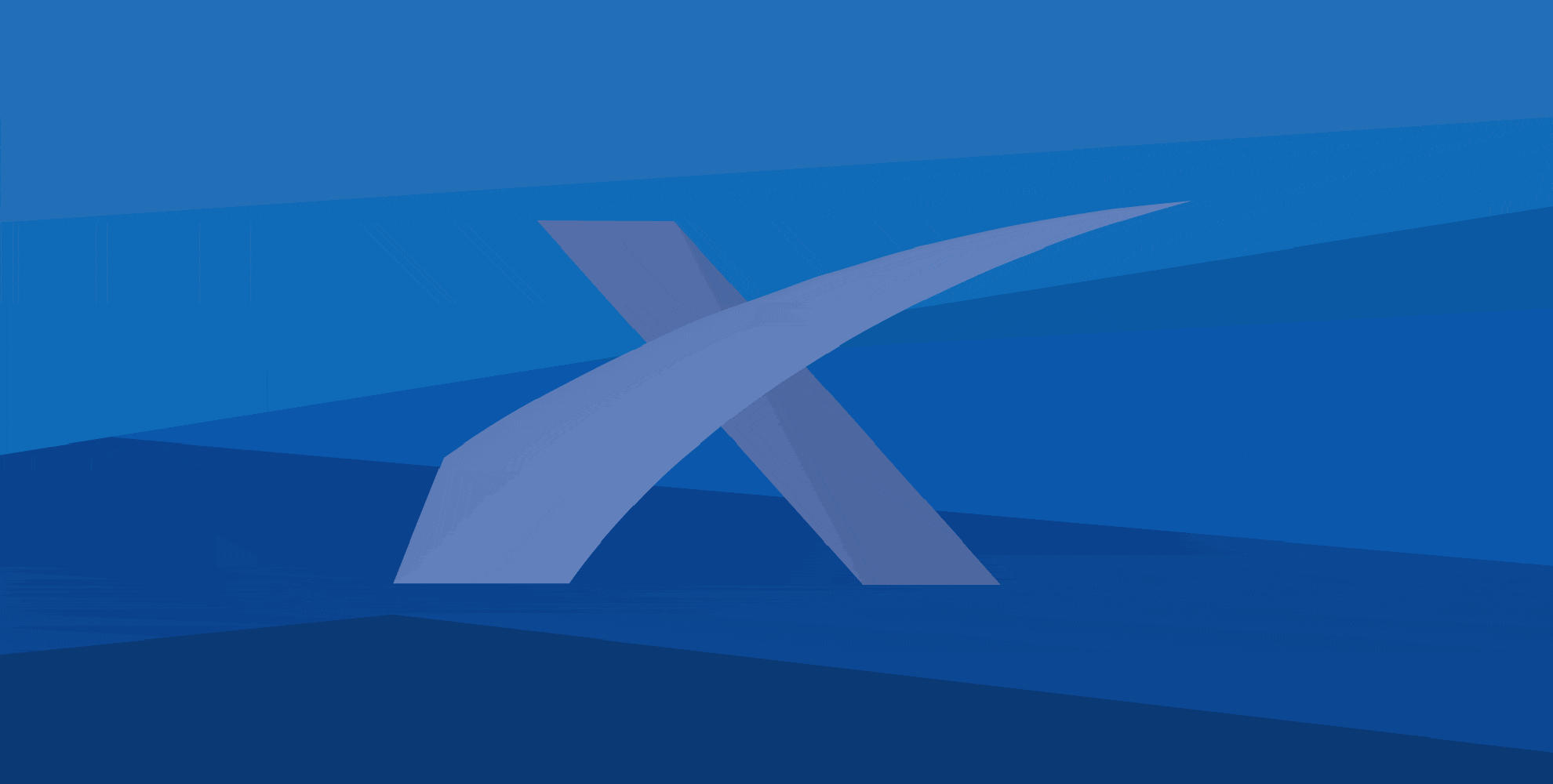Max W. Gurtner, Jahrgang 1951, gehört in der Schweiz zu den wenigen Kommunikationsexperten mit Führungserfahrung in den verschiedensten Branchen. Nach dem Studium der Volkswirtschaft und Soziologie an der Universität St. Gallen (lic. oec. HSG) wirkte er am Gottlieb Duttweiler-Institut (GDI), wo er als Leiter PR und Verlag u.a. die Zeitschrift GDI Impuls lancierte. 1986 folgte er dem Ruf von Hoffmann-La Roche, wo er zuerst als Pressechef und dann als Leiter Corporate Communications tätig war. Als Senior Vice President Investor Relations der Roche Gruppe baute er die Beziehungen zur Financial Community auf und internationalisierte das Aktionariat unter der Ägide von Henri B. Meier und Fritz Gerber. In dieser Periode gründete er die Schweizerische Investor-Relations Vereinigung (SIRF) und war u.a. Vorstandsmitglied des Schweizerischen PR-Verbandes (SPRV) und Basel Tourismus. Als Leiter Corporate Communications der internationalen Sportmarketing-Gruppe ISL worldwide, als Leiter Medien und PR der Zurich Financial Services (ZFS) und als selbständiger Berater im Bereich Venture Capital und Börsengänge, erweiterte Max Gurtner seinen Erfahrungshorizont. 2005 wurde er Leiter der Unternehmenskommunikation der SRG SSR. In der Phase des Umbaus der Unternehmensstruktur und der Fusion von Radio und Fernsehen professionalisierte er die Kommunikation und führte ein neues Branding ein. Heute berät Max Gurtner Jungunternehmen. Als Dozent für Krisen- und Finanzkommunikation hat er über Jahrzehnte sein Wissen am Schweizerischen Public Relations Institut (SPRI), am Schweizerischen Ausbildungsinstitut für Marketing, Werbung und Kommunikation (SAWI) sowie an der Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung Zürich (HWZ), wo er heute noch tätig ist, weitergegeben. Im Gespräch mit Christian Dueblin spricht Max W. Gurtner über seine Erfahrungen in der institutionellen Kommunikation mit besonderem Blick auf die Veränderungen im digitalen Zeitalter.
Dueblin: Sehr geehrter Herr Gurtner, Sie begannen Ihre Karriere als Kommunikationsverantwortlicher für das Gottlieb Duttweiler Institut (GDI). Wie sehen Sie aus heutiger Sicht die beiden Steinwürfe von Duttweiler ins Bundeshaus, die im Jahre 1948 zu grossen Diskussionen geführt haben?
Max W. Gurtner: Das Bemerkenswerte dabei ist, dass Duttweiler die Scheiben von innen zertrümmert hat. Er war eben nicht nur ein visionärer Unternehmer, sondern als Politiker auch ein Unruhestifter, der sich mit unkonventionellen Methoden für seine Anliegen, wie in diesem Fall die Landesversorgung, einsetzte. Er hat damit ein eigentliches Kampagnen-PR betrieben, wie es z.B. Greenpeace Jahrzehnte später wieder aufgegriffen hat. Die inszenierte Provokation ist ein wirksames Mittel im Buhlen um die Aufmerksamkeit von Medien und Öffentlichkeit und wird auch in der Werbung zunehmend angewendet. Nicht vergessen dürfen wir dabei, dass Duttweiler seine gesellschaftspolitische Überzeugung in heute noch gültige Inhalte und Sprache gegossen hat.
Dueblin: Könnten Sie uns diese Sprache erklären?
Max W. Gurtner: Zum Beispiel „Wer ist der Narr, jener, der vom Geld geritten wird – oder jener, der das Geld zu reiten versucht?“. Geld ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel, um Werte zu schaffen. Doch die nackte Gier war in den letzten beiden Jahrzehnten das vorherrschende Lebenselixier für Investmentbanker, bonusgetriebene Topmanager und auch für viele Anleger. Oder „Freiwilligkeit ist der Preis der Freiheit.“ Eine freiheitliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ist ohne Ethik und Solidarität nicht überlebensfähig. Wer die Freiheit einseitig für sich in Anspruch nimmt, riskiert deren Einschränkung und provoziert ihr Ende. Und als drittes Beispiel „Der Phantast ist der wahre Realist.“ Die Gesellschaft braucht Visionäre wie Duttweiler oder, um zur Kommunikation der Gegenwart zurückzukehren, Jimmy Wales, der 2011 den Gottlieb Duttweiler Preis erhalten hat. Seine Vision, das Wissen der Welt kostenlos zugänglich zu machen, war noch vor 12 Jahren eine Spinnerei. Heute nutzen weltweit monatlich über 400 Millionen Menschen Wikipedia und profitieren von der Demokratisierung des Wissens. Wales ist damit nicht reicher geworden, sondern ist unermüdlich auf Betteltour für seine Stiftung, um Wikipedia in der Dritten Welt in weiteren Sprachen anbieten zu können. Andere Internetpioniere wie Larry Page und Serge Brin (Google) oder Mark Zuckerberg (Facebook) wurden im gleichen Zeitraum zu Multi-Milliardären – im Fall Zuckerberg auf Kosten der heutigen Aktionäre.
Dueblin: Damit sind wir schon mitten im Thema Digitalisierung angelangt. Was hat sich denn in den letzten 30 Jahren grundlegend verändert in der Kommunikation?
Max W. Gurtner: An den Prinzipien eigentlich nichts, in der Technik und im Verhalten praktisch alles. Die Digitalisierung hat die Art und Weise, wie wir privat und öffentlich miteinander kommunizieren, völlig verändert. Stellen Sie sich die Welt vor ohne Internet und mobile Datenübertragung. Das Internet gibt es erst seit 1969, E-Mail seit 1971, das World Wide Web seit 1989, die Suchmaschine Google seit 1989 und das soziale Netzwerk Facebook seit 2004. Auschlaggebend für die breite Akzeptanz und den Massenerfolg der digitalen Möglichkeiten waren einerseits die Entwicklung von Laptop und Smartphone und andererseits von Verkabelung und Mobilfunk. Zum Durchbruch bei den Nutzerinnen und Nutzern hat auch beigetragen, dass das traditionelle Radio- und Fernsehangebot live und im Archiv im Internet zur Verfügung steht. Heute gilt anything! anywhere! anytime! Wir sind überall und immer erreichbar, wünschen aber auch, überall und zu jeder Zeit Kontakt zu Geschäftspartnern und Freunden sowie den Zugang zum Informations- und Medienangebot. Ob das individuell und gesellschaftlich wünschbar ist, sei mal dahingestellt. Die digital natives, also die Generation der 90er Jahre, kaufen keine Zeitung, hören selten live Radio und schauen kaum lineares Fernsehen. Die jungen Leute nutzen die Medien simultan und komplementär. Sie erledigen ihre Arbeit am PC, hören dazu individuell zusammengestellte Musik, werfen regelmässig einen Blick auf die News ihrer Homepage und chatten gleichzeitig mit Kolleginnen und Kollegen.
Dueblin: Was bedeutet denn dieses veränderte Medienverhalten der Jungen Ihrer Erfahrung nach für die Kommunikation?
Max W. Gurtner: Die traditionellen Medien wie Zeitung, Radio und Fernsehen sind als Massenmedien immer noch ausschlaggebend für das Schaffen von Öffentlichkeit und Meinung. Aber für die Mobilisierung und Motivation zu konkretem Handeln haben die Social Media die traditionellen Medien längst überflügelt. Dafür ein Beispiel: Der arabische Frühling, d.h. die Jasmin-Revolution in Tunesien im Dezember 2010 und im Anschluss daran die Revolten in Libyen, im Sudan, in Ägypten und in Syrien werden gerne als Internetrevolution bezeichnet. Tatsächlich sorgte mit Al Jazeera ein Fernsehsender mit landesübergreifender Berichterstattung für Öffentlichkeit. Parallel dazu organisierten sich die vorwiegend jungen, revoltierenden Leute über Internet und Mobiltelefon. Ein weiteres Beispiel: Mitte Januar 2011 erhielt die auf Facebook lancierte Petition „Radio- und Fernsehgebühren: 200 Franken sind genug“ innerhalb weniger Wochen die virtuelle Zustimmung von rund 135’000 Personen. Auf dem Höhepunkt der Kampagne kamen täglich bis zu 10’000 Online-Unterschriften dazu, und die Billag erhielt Tausende von Protest-Anrufen pro Tag. Die Kampagne war aber nur erfolgreich, solange sie von Blick, 20Minuten und der Sonntagspresse thematisiert wurde. Die Petition verlor rapide an Schwung, als der Boulevard das Interesse daran verlor.
Dueblin: Soziale Netzwerke und Social Media gewinnen also an Terrain. Was bedeutet das für die Unternehmenskommunikation? Haben sie wirklich diese grosse Bedeutung, die man ihnen oft zuspricht?
Max W. Gurtner: Wir müssen den Medienmix in Kommunikation und Werbung anpassen, neu zwischen traditionellen Medien und Social Media. Tendenziell verschiebt sich das Gewicht zu bestehenden oder eigens etablierten Netzwerken, denn mit vielen Anspruchsgruppen lässt sich so ein direkter Dialog aufbauen und pflegen. Das gilt ebenso für die Kommunikation mit Kunden wie etwa mit Investoren und Aktionären. Es ergeben sich im Rahmen des viralen Marketings neue Möglichkeiten für Werbekampagnen oder im Zeichen der Kundenbindung neue Möglichkeiten des Erfahrungsaustauschs oder der Clubzugehörigkeit. Das alles ist nicht neu, wir haben es bisher schon genutzt, aber eben noch nicht unter Einbezug der virtuellen Möglichkeiten. Detaillisten und Serviceunternehmen nutzen die Möglichkeiten der Kundenbindung im Web, ich denke da beispielsweise an Apple, Starbucks oder an die Migros bis hin zu den Steuerämtern. Jede Institution, jedes Unternehmen sollte damit Erfahrungen sammeln; doch einfach mitmachen, um dabei zu sein, genügt nicht. Das Engagement muss nachhaltig sein, das Ziel klar gesteckt werden und die Aktion darf mittelfristig nicht mehr kosten, als sie bringt. Auch ein halbherziges Engagement im Web ist kontraproduktiv. Wer bloggt und twittert, muss sich persönlich engagieren und die Community bei Laune halten.
Dueblin: Sind die Auswirkungen der sozialen Netzwerke auf die interne Kommunikation ähnlich gravierend?
Max W. Gurtner: Die neue Managergeneration mailt, twittert und bloggt. Eine Umfrage am Jahrestreffen 2010 der Deutschen Pressesprecher hat ergeben, dass über 60 Prozent der Chefs mit den Mitarbeitern direkt virtuell kommuniziert. Das ist ein Albtraum für die Kontrollfreaks unter den Kommunikationschefs. Und Kontrolle ist ein wichtiger Bestandteil von Kommunikation. In jedem Gespräch prüfen wir die Reaktion des Gegenübers: Hat er oder sie mich verstanden oder nicht? Wo muss ich nachhaken? In der digitalen Welt müssen Kontrolle und Sprachregelung durch Transparenz und Redundanz ersetzt werden. Das hat auch Auswirkungen auf die Unternehmenskultur: Zwischenhierarchien werden noch obsoleter, der Dienstweg ist nicht der einzige Lehrpfad und Widersprüche treten häufiger zu Tage. Doch das Positive überwiegt: Authentizität ersetzt die oft verfälschte, stufengerechte Kommunikation, die Konfliktfähigkeit wird erhöht und Entscheide werden besser nachvollziehbar.
Dueblin: Sie haben eingangs erwähnt, dass sich an den Kommunikationsprinzipien nichts verändert hat. Was muss gute PR Ihres Erachtens beinhalten, sprich was zeichnet gute und nachhaltige PR-Arbeit aus?
Max W. Gurtner: Gute Kommunikation ist wahrhaftig, authentisch und wahrnehmungsorientiert. Kommunikation basiert auf Vertrauen. Die erste Voraussetzung dafür ist Wahrhaftigkeit, dass Fakten und Inhalt nicht nur der Wahrheit entsprechen, sondern auch überprüfbar und nachvollziehbar sind, das Publikum also nicht mit Fachwissen vollgelabert wird. Wer, wie viele Spin-Doktoren in meiner Branche, Fakten verdreht oder unterschlägt, wird das Vertrauen sehr bald verlieren. Authentizität ist die zweite Voraussetzung, um Vertrauen zu schaffen. Hier stehen Menschen und ihre Persönlichkeit im Vordergrund. Das Publikum merkt sehr schnell, wer sich selbst ist oder wer eine Rolle spielt. Die dritte Voraussetzung sind offene Ohren. Gute Kommunikation beginnt nicht mit Sprechen, sondern mit Zuhören. Wahrnehmungsorientiert kommunizieren bedeutet, dass man die Anliegen und Erwartungen der verschiedenen Anspruchsgruppen kennt und ernst nimmt, denn perception is reality.
Dueblin: Wer PR betreibt, muss also nicht nur ein guter Kommunikator, sondern auch ein guter Zuhörer sein. Viele bekannte Führungspersönlichkeiten stellen in ihrer Karriere fest, dass sie von Informationen abgeschirmt werden. Was haben Sie als Kommunikationschef diverser Firmen diesbezüglich für Erfahrungen gemacht und wie haben Sie sich dabei selber definiert?
Max W. Gurtner: Ein CEO muss seine Ziele beharrlich verfolgen und darf sich nicht durch Geräuschkulissen und Nebenkriegsschauplätze ablenken lassen. Er muss sozusagen mit natürlichen Scheuklappen ausgestattet sein, um seiner Funktion gerecht zu werden. In der Realität werden Topmanager zusätzlich durch ihr Umfeld von der Realität abgeschirmt. Der CEO sitzt in der Wahrnehmungsfalle, sozusagen im Auge des Hurrikans, wo bekanntlich Ruhe herrscht, auch wenn darum herum kein Stein auf dem anderen bleibt. Am Hof sind die Höflinge das Problem, sie halten den König mit guten Nachrichten bei Laune. In dieser Situation braucht es den Hofnarren, der die Wahrheit sagt. Die Wahrnehmung verschiedener Anspruchsgruppen systematisch zu erfassen und weiter zu geben, ist eine wichtige Funktion der Kommunikationsverantwortlichen. Sie sind sozusagen das institutionalisierte Ohr nach aussen. Ich habe bezüglich Akzeptanz dieser Rolle beides erlebt. In 15 Jahren Roche durchwegs unterstützend und positiv, im Fall der ZFS in der Krise der Dotcom-Blase negativ, als mit Sprachregelungen meine Sprache regelrecht zensuriert wurde.
Dueblin: Welche weitere Erfahrungen haben Sie gemacht mit den verschiedenen Chefs? Was raten Sie aus heutiger Sicht einem CEO?
Max W. Gurtner: Medien und Öffentlichkeit reduzieren ein Unternehmen gerne auf eine Person, in der Regel auf den CEO. Dem kann man gezielt entgegenwirken, weitere Verantwortliche im Unternehmen exponieren und damit das Risiko der Wahrnehmung über nur eine Person verkleinern. In unserer mediatisierten Gesellschaft suchen aber viele Chefs selbst den öffentlichen Auftritt und sonnen sich gerne unter ihresgleichen auf der öffentlichen Bühne. Nietzsche konstatierte dazu: „Menschen drängen zum Licht, nicht um besser zu sehen, sondern um besser gesehen zu werden“. Ich halte mich an die griechische Mythologie und vergleiche die Medien mit den Göttern. Je höher man in deren Gunst steht, desto tiefer ist der Fall, wenn sie sich abwenden. Viele Ikonen des Sports, der Kultur oder der Wirtschaft haben diese Erfahrung machen müssen. Ein Manager braucht weder ein Titelbild noch eine Homestory und sollte sich nicht an jeder Hundsverlochete für die Klatschspalten ablichten lassen.
Dueblin: Sie haben sehr vielseitige Erfahrungen in der Wirtschaft sammeln können. Sie waren in der Pharma-, Finanz-, Versicherungs- und auch in der Service Public-Branche tätig. Wo sehen Sie die Hauptunterschiede zwischen der Arbeit für Service public-Organisationen und Institutionen sowie der Arbeit in der Privatwirtschaft?
Max W. Gurtner: Der Unterschied zwischen Privatwirtschaft und Service public ist wesentlich kleiner, als man allgemein annehmen würde. Der Unterschied zwischen den Branchen ist weitaus grösser. Das Medienhaus oder der Detailhändler stehen dem Konsumenten viel näher als die Pharmafirma oder die Versicherung, sind darum in der öffentlichen Wahrnehmung auch glaubwürdiger und symphytischer. Im Service Public kommt zu den Anforderungen des Markts und der Wirtschaftlichkeit der öffentliche Auftrag hinzu. Dadurch werden die Ansprüche komplex und die Anspruchsgruppe Politik und Verwaltung hat einen erheblich höheren Stellenwert als in der Privatwirtschaft.
Dueblin: Ist die Kommunikation im Wettbewerb und im freien Markt nicht anspruchsvoller?
Max W. Gurtner: Nein. Was den sogenannt freien Markt betrifft, frage ich mich eher, wo er denn noch frei ist und greift. Nicht im Pharma- bzw. Gesundheitsmarkt, wo Preise behördlich festgesetzt und kontrolliert werden, wo der Kostenverursacher nicht direkt zur Kasse gebeten wird und wo trotz Kostenexplosion die Kostentransparenz für den Patienten fällt statt steigt. Im Sportmarketing vom freien Markt zu sprechen, wäre ein Hohn. Weltsportverbände wie etwa die IHF (Handball) oder die FIFA (Fussball) sind von Korruption gezeichnete, globale Monopole. Der Markt spielt auch nicht überall bei den Versicherungen, wo für die Zweite Säule Mindestverzinsung und Umwandlungssatz behördlich resp. gesetzlich festgelegt werden, wo die Verwaltungskosten weitgehend intransparent sind und wo eine Heerschar von Beratern davon profitiert. Im Detailhandel könnte man annehmen, dass der Markt spielt. Doch für Agrarprodukte spielt der Markt überhaupt nicht. Und die marktbeherrschenden internationalen Konsumgüterkonzerne betrachten die Schweiz überwiegend als Milchkuh, denn die Einstandspreise für Detaillisten in der Schweiz liegen teilweise über den Discountpreisen im benachbarten Ausland. Am Kiosk zahlen wir für deutschsprachige Zeitschriften zwischen 35 bis 100 Prozent mehr als jenseits der Grenze; weder der Preisüberwacher noch die Valora, Besitzerin der Kiosk AG, tun etwas dagegen.
Dueblin: Und wie sieht es diesbezüglich bei anderen Medienangeboten aus? Wir Schweizer zahlen ja mittlerweile die höchsten Empfangsgebühren in Europa.
Max W. Gurtner: Bevölkerung und Politik haben der SRG SSR den Auftrag gegeben, Radio- und Fernsehprogramme in vier Sprachen und entsprechende Inhalte auch online anzubieten, um damit in der Schweiz ein unabhängiges, für die direkte Demokratie und die nationale Identifikation wichtiges Medienangebot sicher zu stellen. Die Mehrsprachigkeit ist in der Tat kostspielig und wir Deutschschweizer zahlen solidarisch für Angebote in Französisch, Italienisch und Rumantsch. Das Budget der gebührenfinanzierten SRG SSR entspricht aber einem Bruchteil der Konkurrenz aus Deutschland, Italien oder Frankreich, die jeweils nur eine Sprache bedient. Der Wettbewerb ist international und die kleine Schweiz kann sich dem nicht entziehen. Wir zappen durch eine zunehmende Flut ausländischer Fernsehkanäle und surfen auf Internetportalen wie Google und Facebook. Der Wettbewerb und der Kampf um Marktanteile finden zunehmend online statt, wo wir auch fernsehen und Radio hören. Die Strukturkrise hat sowohl die Schweizer Verleger als auch die SRG erfasst. Der Eigenproduktionsgrad des Fernsehens schwankt je nach Region zwischen tiefen 16 bis 21 Prozent. Der Konsolidierung im Verlagsgeschäft sind fast alle unabhängigen Regionalzeitungen zum Opfer gefallen. Unter Kostendruck verkleinern die Zeitungsverleger ihre Redaktionen derweil weiter, sowohl die Vielfalt als auch die Qualität des Angebots nehmen ab.
Dueblin: Wohin geht die Branche? Welche Medienpolitik braucht die Schweiz?
Max W. Gurtner: Die Branche braucht und erprobt neue Businessmodelle. Die Verleger setzten auf kostenpflichtige Online-Inhalte. Das ist nicht einfach, nachdem die gleichen Verleger ihr Publikum an Gratis-Zeitungen, Gratis-Portale und Gratis-Apps gewöhnt hat. Die SRG sucht und braucht die Online-Präsenz, denn das Hybrid-Fernsehen steht vor der Tür. Eine neue Gerätegeneration verbindet die Möglichkeiten des Internets mit den traditionellen Fernsehinhalten. Das eröffnet neue Möglichkeiten der Inhalts-Vertiefung und der Interaktivität. Die Schweizer Medienpolitik reagiert auf das Szenario des veränderten Medienkonsums im digitalen Zeitalter zurückhaltend und vorsichtig. Die Verleger stemmen sich gegen den Ausbau der Online-Inhalte und die Online-Werbung der SRG. Sie setzen auf eigene Online-Portale, um so Ausfälle im Printbereich zu kompensieren. Doch um eine kritische Masse an Nutzern zu erreichen, braucht ein Internetportal ein attraktives Multimedia-Angebot. Nur wenn die Schweizer Medien ihre Kräfte bündeln, haben sie gegen die Übermacht der globalen Portale eine reelle Chance. Der Bundesrat sollte darum mit einer aktiven Medienpolitik die Zusammenarbeit zwischen der SRG und den Verlegern im Online-Bereich fördern.
Dueblin: Um PR zu betreiben, muss man also das „Geschäft“ verstehen. Das ist je nach Branche nicht immer ganz einfach. Wie haben Sie sich jeweils eingearbeitet und was waren die Vorteile davon, dass Sie geschäftliche Vorgänge als Ökonom analysieren konnten?
Max W. Gurtner: Sicher war das Studium an der HSG eine ideale Voraussetzung. So lernt man in einem gegebenen, wissenschaftlich erhärteten Referenzsystem systematisch zu denken und – ebenso wichtig – die richtigen Fragen zu stellen. Das Kommunikationshandwerk habe ich Schritt für Schritt on the job erlernt, zuerst als Journalist und Seminarleiter, später als Presse- und Kommunikationsverantwortlicher. Ausschlaggebend für die Ausübung meiner Funktion in verschiedenen Branchen war für mich, dass ich einerseits die Wertschöpfung verstehe und andererseits die Kunden und ihre Bedürfnisse kenne. So habe ich beispielsweise nach einem Stage in einer Versicherungsagentur nie verstanden, warum die Zürich glaubte, Versicherungen und Finanzdienstleistungen aus einer Hand verkaufen zu können. Da wurde dem Unterschied der Kundenbeziehung zum Vermögensverwalter einerseits und zum Versicherungsexperten andererseits nicht Rechnung getragen. Das Abenteuer Allfinance hat denn auch Schiffbruch erlitten und die Aktionäre viel Geld gekostet.
Dueblin: Die Schweiz hat in den letzten Jahren einige Rückschläge einstecken müssen. Vor allem rund um die traditionellen Schweizer Bankengeschäfte ist es zu grossen Veränderungen gekommen – unter Druck anderer Staaten. Mir scheint, dass sie in Sachen Kommunikation und Krisenmanagement oft überfordert war.
Max W. Gurtner: Die Schweizer Grossbanken haben sich nach der Chefgeneration von Nikolaus Senn und Robert A. Jeker Renditeziele gesetzt, die mit einem vorsichtigen und sauberen Geschäftsmodell gar nicht zu erreichen sind – Martin Ebner und sein Primat des shareholder value lassen grüssen. Und die Banken pflegen einen abgehobenen, ja arroganten Kommunikationsstil. Die Schweiz sei reich geworden durch Schwarzgeld, meinte z.B. Sergio Ermotti im Sonntagsblick kurz nach seiner Ernennung zum CEO der UBS. Damit überschätzt er die Rolle seiner Branche und blendet über 100 Jahre Schweizer Industriegeschichte aus. Es ist grotesk und erinnert an Seldwyla, dass die offizielle Schweiz die Welt belehren wollte, dass es einen Unterschied gibt zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. Die Banken hatten und haben eine wichtige volkswirtschaftliche Funktion. Doch über diese hinaus haben sich viele von ihnen – getrieben von einem unangebrachten Renditestreben – auf Risiken eingelassen, die sie selbst nicht mehr verkraften konnten, mit fatalen volkswirtschaftlichen Kosten und politischen Folgen.
Dueblin: Warum steht Ihres Erachtens die Schweiz im Zentrum des internationalen Steuerstreits? Ist das auch eine Folge schlechter Kommunikation?
Max W. Gurtner: Die Schweizer Banken haben den Bogen mit ihrer aktiven Begünstigung von Steuerflucht überspannt und sich in der Kommunikation hinter der offiziellen Schweiz versteckt. Die Politik muss die Suppe auslöffeln. Doch vergessen wir nicht – es gibt beispielsweise auch in Delaware oder auf den Kanalinseln völlig legale Steuerschlupfmöglichkeiten. Und am Bankkundengeheimnis in Österreich oder in Luxemburg rüttelt niemand. Warum also räumen die USA nicht vor der eigenen Tür? Warum hat sich die EU auf die Schweiz eingeschossen? Ich denke, dass der Erfolg und die Prosperität der Schweiz die Aufmerksamkeit vieler Staaten auf sich gezogen haben. Unsere vergleichsweise moderaten Steuersätze und die automatische Schuldenbremse des Bundes haben Modellcharakter. In der krisengeschüttelten und multipolaren Welt rücken nationale Eigeninteressen wieder in den Vordergrund, es gilt das Recht des Stärkeren. Und der Musterschüler darf doch nicht annehmen, dass ihn die Klasse auch noch mag und deswegen schont. Die Schweiz ist eine leichte Beute, da sie zudem nicht in eine schützende Gemeinschaft eingebunden ist. Als exportorientiertes und international verflochtenes Land sind wir global auf Goodwill angewiesen. Der Aufwand, den wir im Alleingang betreiben müssen, wird immer grösser. So wird viel politische Energie im Bilateralismus absorbiert und anstehende strukturelle Aufgaben kommen zu kurz.
Dueblin: An welche strukturellen Aufgaben denken Sie dabei? Was könnte die offizielle Schweiz diesbezüglich von der Privatindustrie lernen?
Max W. Gurtner: Die Schweiz ist ein Erfolgsmodell; politische Stabilität, Innovationskraft, eine effiziente Infrastruktur und kulturelle Vielfalt sind einige der Gründe dafür. Die Schweiz hat ihre historische Chance nach dem Zweiten Weltkrieg genutzt. Als Europa in Schutt und Asche lag, konnte sie dank einer intakten Infrastruktur die wirtschaftliche Basis für Jahrzehnte der Prosperität schaffen. Doch der Erfolg hat Schattenseiten. Man vergisst, worauf der Erfolg basiert und geht fahrlässig mit diesen Faktoren um. Unser Bildungssystem, die Voraussetzung für Innovation, verliert wegen föderalistischer Egoismen den Anschluss. Die Universitäten haben diversifiziert, statt sich auf ihre Kernkompetenzen zu fokussieren; teilweise wiederholen die Fachhochschulen diesen Fehler. Lediglich die eidgenössischen Hochschulen sind an der internationalen Spitze von Forschung und Lehre dabei. Bei der Patenterteilung nimmt die Schweiz zwar international einen Spitzenplatz ein, doch im Finanzplatz Schweiz fehlt es an Risikokapital, dem Treibstoff für die Innovation. Die Effizienz im Service public muss auch dringend verbessert werden.
Dueblin: Haben Sie Beispiele dafür?
Max W. Gurtner: Infrastruktur und Angebot in den Bereichen Gesundheit und Bildung müssen konzentriert werden. In der Schweiz bringt die Bündelung der Kräfte auf Kernkompetenzen mehr Qualität und ist kosteneffizienter als der kleinräumige Wettbewerb. Es ist auch zumutbar, dass man für eine spezielle Operationen oder ein spezialisiertes Studium in einen anderen Kanton geht. Im ganzen Service public – Bereich braucht es eine bessere Koordination. So haben zum Beispiel fast alle Kantone ihr Budget für Bussen im Strassenverkehr drastisch erhöht, zum Wohl der Staatskasse und nicht zur Erhöhung der Sicherheit. Gleichzeitig fahren die Polizeikorps der Kantone Dutzende unterschiedlicher Automarken und werden an Dutzenden unterschiedlicher Typen von Faustfeuerwaffen ausgebildet. Allein mit gemeinsamer Beschaffung und standardisierter Ausbildung liessen sich zig Millionen von Franken einsparen. Wir müssen die Strukturen auf mehr Effizienz trimmen, so wie es die Privatwirtschaft längst getan hat. Bei der Zusammenlegung von Radio und Fernsehen ging es der SRG nicht nur um die Medienkonvergenz, sondern auch um handfeste Einsparungen in Funktionen wie Einkauf, Personal, IT, Kommunikation und Management. Wie die konsequente Zusammenlegung von wirtschaftlich nicht überlebensfähigen Gemeinden wäre die Fusion von Halbkantonen und kleinen Kantonen ein konsequenter Schritt. Doch das ist die wohl heiligste der helvetischen Kühe. In Baselland, wo die Regierung im letzten Jahrzehnt besonders schlecht gewirtschaftet hat, wehren sich Exponenten aus Politik und Verwaltung allein schon gegen eine Diskussion eines Zusammenschlusses mit Baselstadt – und damit gegen ihre eventuelle Abschaffung. Unser politisches System war zwar erfolgreich im Verwalten des Erfolgs, tut sich aber schwer mit Paradigmenwechseln.
Dueblin: Sie helfen Firmen beim „Branding“. Erkennen Sie in der Wirtschaft versteckte Potentiale, welche die Schweiz, die unter einem wirtschaftlich angespannten Umfeld leidet, noch ausschöpfen könnte?
Max W. Gurtner: Swiss, Swiss Made, Swiss Engineered und Swiss Quality sind weltweit anerkannte Gütesiegel, das gilt vor allem auch für die aufstrebenden Märkte in China und Fernost. Wir sollten also weiter auf diese Marke setzen und zu ihr Sorge tragen, auch mit der sogenannten Swissness-Vorlage im Parlament, welche den Anteil Schweiz in den Produkten mit Schweizer Kreuz festlegen muss. Nach den Multis haben viele exportorientierte Klein- und Mittelbetriebe, das Rückgrat unserer Wirtschaft, rigoros ihre Strukturen anpassen müssen. Nur so konnten sie seit Einführung des Euro den Anstieg des Schweizer Frankens um über 30% auffangen. Diese wirtschaftliche Anpassungsfähigkeit und Fitness sind hoch einzuschätzen, nennen wir diese Markeneigenschaft doch Swiss Flexibility, sie kann auch mit unseren multikulturellen Fähigkeiten und Kundenorientierung in Zusammenhang gebracht werden.
Dueblin: Und im Tourismus? Ich denke da an Ihre Erfahrungen bei Basel Tourismus.
Max W. Gurtner: Der Tourismus leidet in der Tat unter dem starken Franken. Wer teurer ist, muss besser sein und auf Qualität setzen. Doch die Marke Schweiz ist im Tourismus bezüglich Qualität schwächer positioniert als beispielsweise die Marken St. Moritz, Luzern oder Zermatt, als Graubünden oder das Wallis. Das ist typisch für die Schweiz, man tut sich schwer beim Finden des gemeinsamen Nenners, der gemeinsamen Strategie in der internationalen Vermarktung. Soll der Tourismus nachhaltig Werte schaffen, muss man weniger auf den Zweitwohnungsbau und wieder mehr auf eine attraktive Beherbergung setzten. Das touristische Produkt und damit die Marke ist ein Gesamterlebnis und kann nicht auf einen Slogan reduziert werden. Der Service ist wichtigster Bestandteil des Erlebnisses, der Gast muss sich als solcher aufgenommen fühlen. Das braucht Personal, das sich mit dem Produkt und seiner Rolle identifiziert. Man spricht in diesem Zusammenhang von behavioral branding. Die Gastfreundschaft ist vielerorts im Schweizer Gastgewerbe noch verbesserungsfähig, gerade auch im Vergleich zur Konkurrenz etwa in Österreich.
Dueblin: Was wünschen Sie sich für die Zukunft und als PR-Experte für die Schweiz?
Max W. Gurtner: Dass die Verantwortlichen dieses Landes über die Parteigrenzen hinweg vermehrt Lösungen erarbeiten und dann auch durchsetzen. Doch leider hat sich das politische Klima in den letzten 10 Jahren verschlechtert. Die grösste Partei des Landes ist die populistische Taktgeberin, es geht ihr dabei aber primär um Wählerstimmen und nicht um Lösungen. Den übrigen Parteien gelingt es nur ab und zu, die politische Agenda zu besetzen. Zulange haben sie Interessen oder Ideologien vertreten statt Probleme, die das Volk bewegt, ernst zu nehmen. Der Exekutive gelingt es nicht, mit einer Stimme zu sprechen. In Bern hat jedes Departement und jedes Bundesamt eigene Kommunikationsabteilungen. Da weiss die rechte Hand oft nicht, was die linke tut. Und wem ein Entscheid nicht passt, der kommuniziert über die Indiskretion, die für die Medien attraktivste Form der Informationsvermittlung. Man verfolge etwa das kommunikative Trauerspiel um die Kampfflugzeugbeschaffung, wo der Graben mitten durch das VBS und die Armeespitze verläuft, wo die der Armee nahestehende, grösste PR-Agentur des Landes den offiziellen Bundesratsbeschluss mit allen Mitteln bekämpft. Es ist auch stossend, dass Angriffe auf die Schweiz von den politischen Eliten aller Couleur dazu benutzt werden, sich abzugrenzen und zu profilieren statt zusammenzustehen und eine Lösung durchzusetzen, so etwa in der Krise der nachrichtenlosen Vermögen oder des Bankkundengeheimnis. Die politische Schweiz ist in der öffentlichen Wahrnehmung zu oft mit Krisenmanagement beschäftigt und spricht darüber, weil Krisen sexy sind und sich daraus politisches Kapital schlagen lässt. Wichtige Geschäfte kommen derweil zu kurz und die heissen Eisen werden lieber jahrelang zerredet als energisch angefasst, man denke etwa an die Asylpolitik. Das effiziente Vorgehen während der Finanzkrise war möglich, weil nur Bundesrat und Finanzdelegation involviert waren und unter Notrecht entscheiden mussten. Die Schweiz verdient mehr politische Führung und weniger politisches Taktieren – nicht nur unter Notrecht.
Dueblin: Sehr geehrter Herr Gurtner, ich bedanke mich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute bei Ihren Tätigkeiten.
(C) 2012 by Christian Dueblin. Alle Rechte vorbehalten. Anderweitige Publikationen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors gestattet.