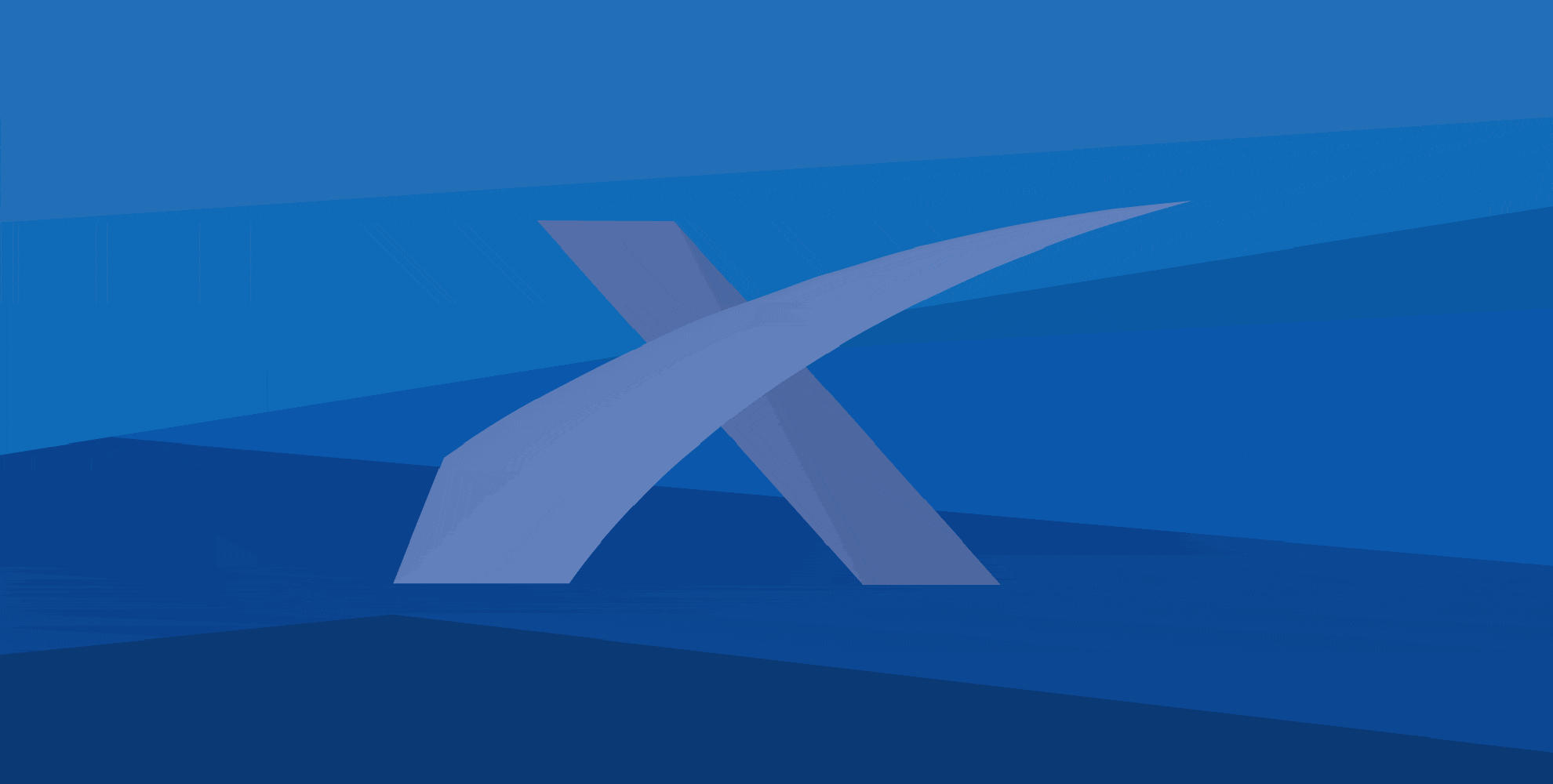Prof. Dr. Gottfried Schatz
Prof. Dr. Gottfried Schatz, Jahrgang 1936, gehört zu den herausragendsten Biochemikern und Forschern unserer Zeit. Der gebürtige Österreicher übernahm nach zahlreichen Stationen als Student, Postdoktorand und Professor an Universitäten und biochemischen Instituten in Österreich (1954 bis 1964) und den USA (1964 bis 1974) eine Professur am Biozentrum der Universität Basel, das er von 1983 bis 1985 leitete (emeritus 2000). Für seine Forschungsarbeiten wurde er mit über 20 nationalen und internationalen Preisen und Ehrendoktorwürden ausgezeichnet und mit einer Vielzahl von Aufsichtsratsmandaten auf der ganzen Welt betraut. Prof. Dr. Gottfried Schatz präsidierte von 2000 bis 2003 den Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierat, ein Gremium, das den Bundesrat in Bezug auf wissenschaftliche und technologische Weichenstellungen in der Schweiz berät und unterstützt. Im Gespräch mit Christian Dueblin spricht Prof. Dr. Gottfried Schatz über Technologie und Forschung, gibt Auskunft über die Situation der Universitäten in Europa und den USA und zeigt auf, wo die Grenzen der Forschung liegen.
Dueblin: Herr Prof. Dr. Schatz, Sie sind einer der bekanntesten Forscher in der Schweiz, kommen aber aus Österreich. Wären Sie einverstanden damit, wenn Sie als Glücksfall für die Schweizer Forschungs- und Wissenschaftslandschaft bezeichnet würden?
Prof. Dr. Gottfried Schatz: Das wäre zu viel der Ehre, denn die Schweiz besitzt zum Glück sehr viele hervorragende Forscher. Manchmal bedaure ich es, dass ich mich mit bildungspolitischen „Nischen“ beschäftige, die es eigentlich gar nicht geben sollte.
Dueblin: Wie würden Sie diese Nischen beschreiben?
Prof. Dr. Gottfried Schatz: Die wissenschaftliche und technologische Innovation der Schweiz war, wie im Übrigen die von ganz Europa, jahrzehntelang von älteren Männern dominiert. Die jüngeren Menschen fungierten sehr oft nur als Hilfskräfte. Dies hat die Innovationskraft des ganzen Kontinents erheblich geschwächt, weil diese „Hilfskräfte“ keine adäquaten Chancen hatten, ihre eigenen Ideen zu entwickeln. Die unbefriedigende Situation vieler junger Forscherinnen und Forscher ist die erste Nische, die mich beschäftigt. Eine zweite Nische ist das fehlende Verständnis für die Rolle des Einzelnen. Wirklich neue Ideen kommen fast immer von besonders innovativen Einzelpersonen, die sehen, was die Meisten sehen, dabei aber denken, was noch keiner gedacht hat – Menschen, die den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen und gerade deswegen Neues zu entdecken. Heute neigt man immer mehr dazu, Forscherkollektive zu unterstützen. Dabei schafft man unweigerlich hierarchische Strukturen, obwohl wir wissen, dass diese die Innovationskraft hemmen. Ich kämpfe dafür, dass unsere Politiker und Verwaltungen erkennen, dass wirklich innovative Forschung von den Ideen einzelner Menschen getrieben wird und meist nicht in allen Details planbar ist.
Dueblin: Viele junge Forscher und Wissenschafter in der zweiten Reihe sind sich wohl ihrer Rolle als Zulieferer bewusst, müssen jedoch aufgrund der äusseren Umstände gute Miene zum bösen Spiel machen. Sie dürfen sagen, was manch eine Nachwuchskraft die Karriere kosten könnte.
Prof. Dr. Gottfried Schatz: Da haben Sie sehr Recht und es freut mich, dass Sie diesen Zusammenhang erwähnen. Die beiden erwähnten Nischen zu füllen, bedeutet letztlich auch, die Kritik am richtigen Ort anzubringen. Ein emeritierter Professor ist praktisch unverwundbar. Wäre ich noch aktiver Forscher, wäre ich von Geldgebern und verschiedenen Förderungsagenturen abhängig. Ich bin deshalb bei meiner vorzeitigen Emeritierung bewusst „ausgestiegen“, habe mein Büro am Biozentrum der Universität Basel aufgegeben und arbeite heute nur noch von zuhause aus. Deswegen kann ich frei sagen, was ich für richtig empfinde. Ein Nachteil der sonst wunderbaren Schweiz ist, dass sie es sehr ungern sieht, wenn jemand „das Boot schaukelt“, wie man auf Englisch in solchen Situationen zu sagen pflegt. Bildungspolitiker und Universitätsrektoren erwarten von einem Professor und Forscher, dass er sich betont konziliant gibt und bereits mit dem Kompromiss in der Tasche zu den Verhandlungen anreist. Dieser Weg sichert zwar den Frieden, führt aber selten zu echten Verbesserungen oder gar neuen Ideen.
Ich wählte den Weg, den viele einflussreiche Kritiker meiner österreichischen Heimat gewählt haben – wie Karl Kraus, Thomas Bernhard oder Elfriede Jelinek. Dabei geht es darum, die Kritik bewusst pointiert zu formulieren, damit Menschen Probleme, die sie eigentlich sehen sollten, auch tatsächlich sehen. Mit diesem Vorgehen habe ich mir natürlich nicht nur Freunde geschaffen. Aber wer in der Bildungspolitik nur Freunde hat, der muss etwas falsch machen. Die Bildungslandschaft in der Schweiz ist, wie in den meisten europäischen Ländern, eine sehr verkrustete Angelegenheit. Sie wird zudem immer mehr von Politik und Verwaltung gesteuert. Viele wichtige Funktionen und Entscheidgremien wurden von der Wissenschaft an die Verwaltung abgegeben, die heute sehr viel Macht in ihren Händen hält. Innovative Tätigkeiten wie Kunst oder wissenschaftliche Forschung sind dabei die Leidtragenden. Es ist nicht so, dass die Verwaltungen unfähig wären. Im Gegenteil, ich habe in ihnen sehr fähige und motivierte Menschen kennen- und schätzen gelernt.
Organisationen und Verwaltungen haben jedoch die Aufgabe, unerwartete Ereignisse, Regelverletzungen und Fehler zu vermeiden. Unerwartete Ereignisse, Regelverletzungen und Fehler sind aber Kernstücke jeder innovativen Forschung. Deshalb sind Verwaltung und innovative Forschung inhärent Gegensätze. Beide in einem richtigen Verhältnis zu halten, ist sehr schwierig, da dies Demut von beiden Seiten erfordert und diese Demut vor allem den mächtigen Verwaltungen oft fehlt. Es lag mir immer sehr am Herzen, diese Zusammenhänge aufzuzeigen, denn sie haben mit den eingangs erwähnten zwei Nischen unmittelbar zu tun.

Prof. Dr. Gottfried Schatz: Die Welt in der wir leben
Dueblin: Es gab ein Forschungsprojekt Sesam, das gemäss kürzlich erfolgten Zeitungsberichten als gescheitert betrachtet werden muss. Es hätten rund 3000 Kinder in der Schweiz während 20 Jahren auf ihre psychische Entwicklung hin beobachtet werden sollen. Worauf führen Sie das Scheitern dieses Projektes zurück, und was ist der Stellenwert solcher und ähnlicher Forschungsgrossprojekte?
Prof. Dr. Gottfried Schatz: Dieses Vorhaben scheiterte, weil man die Schwierigkeit unterschätze, genügend Freiwillige für eine derart langfristige und emotionell heikle Studie zu finden. Aber ganz abgesehen von diesen technischen Aspekten finde ich solche Grossprojekte keine gute Idee – es sei denn, sie betreffen die technologische Entwicklung oder die klinische Anwendung von Ergebnissen der biomedizinischen Grundlagenforschung. Als Präsident des Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierates war es einer meiner wichtigsten Anliegen, gegen solche von oben verwalteten Netzwerkforschungsprojekte zu kämpfen. Meines Erachtens sollten wir unsere finanziellen Mittel gezielt den besten Köpfen geben und von ihnen dann regelmässig Rechenschaft über die geleistete Arbeit einfordern. Eine Investition in einzelne Forscher ist natürlich riskanter als eine solche in Forscherkollektive. Es ist, wie wenn Sie als Anleger nur in einzelne Aktien anstatt in Fonds investierten. Das Finanzieren von grossen Forschungskollektiven empfinde ich aber aus mehreren Gründen als sehr unglücklich. Erstens führen die dabei notwendigen Strukturen unweigerlich zu Hierarchien. Meist werden solche Forschungsprojekte von einem Top-Wissenschafter angeführt, sodass die jüngeren Teilnehmer sich schnell in einem Abhängigkeitsverhältnis befinden.
Ein junger Forscher will selber bekannt werden und sich nicht im Schatten von Vorgesetzten bewegen müssen. Die jungen Forscher sollten deshalb das Geld direkt zugesprochen bekommen. Zweitens ist die Qualitätskontrolle eines grossen Forschungsprojektes ausserordentlich schwierig. Bei einer Publikation mit sechs verschiedenen Autoren weiss man nur selten genau, wer was gemacht hat. Drittens fallen bei solchen und ähnlichen Projekten immer Verwaltungskosten an. Die Entscheidungen über die Vergabe grosser Netzwerkprojekte sind schliesslich meist auch politisch geprägt – keine gute Basis für eine originelle Forschung. Während meiner Tätigkeit als Präsident des Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierates habe ich dem Schweizerischen Nationalfonds vorgeworfen, dass er fast ein Viertel seiner Mittel für gross angelegte Netzwerk-Forschungsprojekte einsetzt, obwohl er von Forschern mit dem erklärten Ziel gegründet wurde, die freie Grundlagenforschung zu fördern. Unser Gremium tat sein Bestes, um ein weiteres Anwachsen solcher Projekte zu bremsen.
Dies ist uns auch gelungen, doch wir scheiterten bei unserem Versuch, diese Programme zurückzuschrauben. Sesam, das erst einige Jahre später bewilligt wurde, war ein solches Programm. Hier wurde eine sehr komplexe Maschinerie in Gang gesetzt, die dann unter ihrer eigenen Last zusammengebrochen ist. Nicht alle Netzwerkforschungsprojekte haben aber ein so trauriges Schicksal. Manche führen zu wichtigen neuen Erkenntnissen, da ja meist auch sehr gute Forscher beteiligt sind. Meine Kritik gipfelt jedoch in der Frage, wie viel mehr herausgekommen wäre, wenn man das Geld – und hier es geht um erhebliche Summen – nur den Besten gegeben hätte. Diese entscheidende Frage kann grundsätzlich nicht beantwortet werden.
Dueblin: Man soll die Besten finden und ihnen das Geld geben. Wer aber entscheidet, wer die Besten sind? Sind das die Besten in ihrem Fach, oder sind das Menschen, die einen breiten Horizont aufweisen und fächerübergreifend arbeiten können? Wer auch immer Geld gibt, tut das in der Regel mit Zielvorstellungen. Die Forschung soll etwas bringen. Es sollen beispielsweise neue Grundlagen erforscht werden, oder es soll nach etwas geforscht werden, das man in der Industrie umsetzen kann.
Prof. Dr. Gottfried Schatz: Das sind zwei sehr wichtige Fragen, die auch für mich nicht leicht zu beantworten sind. Es gibt kein allgemeingültiges Rezept dafür, wie man „die Besten“ findet. Es gibt jedoch Vorgehensweisen, die sich bewährt haben. Das ideale Rezept ist meines Erachtens, die Auslese einem erfahrenen, fairen und klugen Forscher zu überlassen. Viele der allerbesten Laboratorien der Welt setzen auf dieses Vorgehen. Ein Beispiel ist das berühmte Laboratory for Molecular Biology im englischen Cambridge, aus dem erstaunlich viele umwälzende Entdeckungen in der Biologie hervorgegangen sind. Es hat flache Strukturen, dafür viele herausragende Köpfe mit Führungsqualitäten, die grossteils mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Solche Persönlichkeiten können meist am besten einschätzen, ob jemand fähig ist oder nicht. Eine Entscheidung Einzelner birgt natürlich auch Gefahren, doch wenn die Entscheidungsträger die Richtigen sind, stimmt auch meist die Auswahl.
Eine breiter anwendbare Art der Auslese ist die Selektion durch Gremien von Spitzenforschern, die gemeinsam entscheiden. Wichtig ist, dass diese Gremien international besetzt sind und sich von lokalen Einflüssen abschirmen. Dies ist vor allem für kleine Länder wie die Schweiz wichtig. Wenn ein solches Gremium mit einem Kandidaten für einige Stunden über dessen Arbeit spricht und wissen will, warum er sein Forschungsthema wählte, warum er gewisse Methoden verwendete und was er in Zukunft tun will, ist die Treffergenauigkeit meist erstaunlich hoch. Der persönliche Eindruck nach einem längeren und fundierten wissenschaftlichen Gespräch ist viel verlässlicher als Prüfungsnoten und die Anzahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen.
Ganz entscheidend ist es auch, dass wir ein Umfeld schaffen, in dem sich der freie Wettbewerb der Ideen ungehindert entwickeln kann. Das bedeutet, dass wir keine Seilschaften zulassen und unsere frischgebackenen Doktorinnen und Doktoren dazu anhalten, die Universität zu wechseln und eine zusätzliche Ausbildung im Ausland zu absolvieren, um weitere Erfahrungen zu sammeln und ihr Können in einem anderen Umfeld unter Beweis zu stellen. Es darf nicht sein, dass wir diesen „Postdoktoranden“ schon beim Weggehen Forschungsplätze in der Schweiz in Aussicht stellen. Die jungen Wissenschafter müssen sich einem freien und – was sehr wichtig ist – internationalen Wettbewerb stellen. Seilschaften sind leider in allen Fächern vertreten, in den Geisteswissenschaften und gewissen klinischen Fächern aber derzeit besonders häufig. Seilschaften haben einige Wissenschaften in der Schweiz erheblich provinzialisieret.
Es gibt verschiedene Arten von Forschung mit verschiedenen Zielen, doch jede Art erfordert innovatives Denken, Durchhaltewille, Motivation und Können. Die verschiedenen Arten von Forschungen unterscheiden sich vor allem durch ihren Zeitrahmen. Grundlagenforschung hat einen unbestimmten Zeitrahmen und oft auch ein unbestimmtes Ziel. Oft schafft sie sich erst ihre eigenen Ziele und bereitet so den Boden für die technischen Innovationen von morgen. Diese Forschung ist besonders verletzlich, weil sie dem Steuerzahler keine konkreten Versprechungen machen kann und deswegen leicht den Anschein von wissenschaftlicher Arroganz erweckt. Ausserdem ist unsere Gesellschaft kurzfristigem Denken verpflichtet, das selten über einen Zeitraum von 3 – 5 Jahren hinausgeht. Deshalb sollten wir die Grundlagenforschung einem universitären Umfeld anvertrauen, da dort Menschen noch darüber nachdenken, was in fünfzig oder hundert Jahren geschehen könnte. Es ist kontraproduktiv, dieser Art von Forschung Ziele vorzugegeben, weil sie sich diese, wie bereits gesagt, meist selber schafft.
Es gibt auch kürzerfristige Forschung, deren Ziel es ist, bereits vorhandene Ergebnisse der Grundlagenforschung zu bündeln und praktisch anzuwenden. Eine Firma könnte zum Beispiel daran arbeiten, die Effizienz eines Automotors zu verbessern. Diese Art von Forschung lässt sich besser planen und durch eine straffe Organisation und konkrete Zwischenziele (die berühmten „Milestones“) erheblich beschleunigen. Zwischen diesen beiden Arten von Forschung gibt es eine Grauzone, die für die Grundlagenforschung etwas zu „angewandt“ und für ein Unternehmen zu „theoretisch“ ist. Hier ergibt sich für den Staat die Möglichkeit, als Partner und Vermittler aufzutreten. In der Schweiz gibt es beispielsweise die Kommission für Technologie und Innovation (KTI), die Projekte in dieser Grauzone fördert. Die KTI vergibt staatliche Gelder, verlangt aber gewöhnlich von der Industrie, für die Hälfte der Fördersumme aufzukommen. Ein schönes Beispiel für solche Forschungsarbeiten ausserhalb der Schweiz ist das genaue Studium der Verbrennungsschichten in Automotoren durch japanische Autokonzerne, oder die internationale Zusammenarbeit am Fusionsreaktor im französischen Cadarache.
Dueblin: Sie waren jahrelang im Ausland und ein Blick auf Ihre internationalen Preise und Auszeichnungen macht einem schwindlig. Sie haben gesagt, dass sich die Schweiz in Bezug auf Forschung und Bildung nicht wesentlich von Europa unterscheide. Wo sehen Sie Unterschiede in der Forschung zwischen den USA und Europa, also auch der Schweiz?
Prof. Dr. Gottfried Schatz: Die Schweiz hat einige Stärken, die sie nicht nur im europäischen, sondern auch im internationalen Umfeld auszeichnen. Ihre Bevölkerung ist hervorragend ausgebildet und, im Gegensatz zum weit verbreiteten Klischee, sehr international ausgerichtet. Selbst Ausländer wie ich können führende Stellungen in der Bundespolitik besetzen. Dies ist nicht selbstverständlich. Natürlich verfügt die Schweiz auch über eine bewundernswerte Infrastruktur und grossen Reichtum. Das sind alles Aspekte, die für eine gute Forschung wichtig sind. Der Nachteil der Schweiz ist ein übertriebener Egalitarismus, der es dem Land verwehrt, ganz vorne an der Spitze sein zu wollen. Die Vision der Schweiz ist es, hinter den USA die Nummer Zwei zu sein – doch Nummer Zwei zu sein, ist keine inspirierende Vision. Keines der mir bekannten Länder besitzt so viele Voraussetzungen für eine erstklassige Forschung wie die Schweiz. So etwas offen auszusprechen ist natürlich unschweizerisch, denn eine der schönen Eigenschaft der Schweiz ist ihre Bescheidenheit. Ich habe diese Eigenschaft immer sehr geschätzt, doch in Wissenschaft und Kunst zählt sie wenig oder nicht. Nur im Sport scheint die Schweiz kein Problem zu haben, offen den ersten Platz anzustreben. Dies beweist jede Reportage über ein Tennisturnier oder ein Skirennen. Wenn es um Wissenschaft geht, lässt die Schweiz einen solchen Ehrgeiz vermissen. Dieses Paradox gilt es zu verstehen und zu bekämpfen.
Dueblin: Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch in Bezug auf Sport und Wissenschaft?
Prof. Dr. Gottfried Schatz: Wissenschafter sind bisher gegen aussen meist sehr bescheiden aufgetreten. Es gab allerdings auch Ausnahmen – charismatische und erfolgreiche Medienstars wie der Physiker Richard Feynman, der Chemiker Linus Pauling, der Biologe James D. Watson und der Astronom Carl Sagan. Sie alle waren Amerikaner. Dies ist sicher kein Zufall, denn europäische Wissenschaftler finden ein solches Auftreten als unter ihrer Würde. Sie haben wohl Angst, von ihren Kollegen als „mediensüchtig“ abgestempelt zu werden. Viele Forscher in Europa versuchen, würdig und gesetzt zu wirken – in den USA würden sie als „stuffy“ oder „nerdy“ gelten – beides keine schmeichelnden Ausdrücke. Ein solches Gehabe entspricht in keiner Weise dem Wesen innovativer Wissenschaft, denn diese ist dynamisch, emotionell, revolutionär und respektlos. Das ist ein Grund, warum ich eine Serie von Essays für die NZZ zu schreiben begann. Ich wollte aufzeigen, dass Wissenschaft eine Schwester der Kunst ist und ebenso wie diese intuitiv und voller Überraschungen ist. Wir müssen zudem unsere Studenten lehren, mit der Öffentlichkeit Kontakt zu pflegen. Dazu braucht es Tage der offenen Tür und ähnliche Veranstaltungen, an denen Studenten und Professoren ihre Welt einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Nur so können wir die Zukunft hochrangiger Forschung in unseren Demokratien sicherstellen.

Prof. Dr. Gottfried Schatz: Jenseits der Gene. ISBN 978-3038234531
Dueblin: Prof. Dr. Malik sieht im Interview mit Xecutives.net die Intuition als eine Voraussetzung und Chance für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens, da sie auf langjähriger Erfahrung basiere. Wo genau spielt Ihrer Ansicht nach die Intuition in der Forschung eine Rolle? Eine wirklich innovative Idee entspringt ja nicht allein der Logik, sondern oft einem nicht vorhersehbaren intuitiven „Gedankenblitz“.
Prof. Dr. Gottfried Schatz: Natürlich braucht Wissenschaft Sortier- und Aufräumarbeit, das Ordnen und Katalogisieren von Fakten. Dies ist aber nicht ihre wichtigste Aufgabe. Wissenschaft beschäftigt sich nicht so sehr mit Wissen, sondern vor allem mit Unwissen. Sie will herauszufinden, was wir noch nicht wissen. Nur so kann sie uns wirklich innovative Ideen und Erkenntnisse schenken. Doch was ist „innovativ“? Ein Ergebnis ist innovativ, wenn es uns überrascht. Je grösser die Überraschung, desto höher ist der Innovationsgrad der Erkenntnis. Das gilt nicht nur für eine wissenschaftliche Entdeckung, sondern auch für ein Kunstwerk. Organisation und Hierarchie hemmen solche Innovation. Deshalb ist das ideale Umfeld für Innovation das kontrollierte Chaos. Je flacher die Hierarchie, desto grösser die Chancen für innovative Entdeckungen.
Das Biozentrum, das ich zwei Jahre lang leiten durfte, war in dieser Beziehung für die Schweiz ein Vorbild, denn es liess junge Forscher schon vor drei Jahrzehnten unabhängig arbeiten und versprach ihnen, ihre befristeten Verträge bei guter Leistung in unbefristete umzuwandeln und sie dann den ordentlichen Professoren weitgehend gleichzustellen. Dieses Karrieremodell entspricht im Wesentlichen den an US-Spitzenuniversitäten bewährten Assistenzprofessuren. Heute ist dieses Vorgehen bei vielen, aber leider noch nicht allen, Schweizer Universitäten eingeführt, obwohl sich diese zum Teil heftig gegen diese Neuerung wehrten. Vor allem Vertreter der Geisteswissenschaften sahen in ihnen eine Bedrohung ihrer Wissenschaft – obwohl dieses System an den allerbesten geisteswissenschaftlichen Fakultäten der USA seit Jahrzehnten die Regel ist. Meines Erachtens ist die bei uns immer noch weit verbreitete Habilitation ein veraltetes und schlechtes Instrument für Nachwuchsförderung und Qualitätssicherung.
Das Argument, eine Habilitation erlaube genügend Zeit, um „das grosse Buch“ zu schreiben, stimmt zwar, doch es vergisst, dass die Habilitanden bei Beendigung dieses „grossen Buchs“ meist schon viel zu alt sind, um bei Ablehnung ihrer Habilitation eine andere Karriere zu beginnen. Bei einer Habilitation kommt die Auslese meist viel zu spät. Die Auswahl sollte möglichst früh und immer auf internationaler Ebene getroffen werden. Einige Kollegen haben mich wegen meiner Ansichten in dieser Sache namentlich und in renommierten Tageszeitungen angegriffen. Manchmal frage ich mich, ob unsere europäischen Universitäten überhaupt noch reformfähig sind. Sie sollten brodelnde Ideenküche sein, zählen jedoch heute zu den konservativsten Institutionen unserer Gesellschaft.
Dueblin: Sie implizieren, dass es Universitäten gibt, wo das anders ist?!
Prof. Dr. Gottfried Schatz: Richtig. Ich bin an einer dieser Universitäten, der Cornell Universität in Ithaca, New York, als Wissenschaftler erwachsen geworden, kenne aber auch die meisten anderen Spitzenuniversitäten der USA sowie Cambridge und Oxford recht gut. Dasselbe gilt für die beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen, die in vielen Belangen sehr viel fortschrittlicher (aber auch besser finanziert) als unsere Universitäten sind. Die meisten Spitzenuniversitäten finden sich aber nicht in Europa, sondern immer noch in den USA.
Dueblin: Gerne möchte ich noch einmal Prof. Dr. Fredmund Malik nennen. Er vertritt im Interview mit Xecutives.net die Meinung, dass die Finanzkrise auch auf ein von den USA geprägtes Ausbildungssystem zurückzuführen sei. Generationen von Menschen seien falsch programmiert worden. Sie sehen das somit in Bezug auf die Ausbildung von Naturwissenschaftern anders.
Prof. Dr. Gottfried Schatz: Ich sehe keinen Widerspruch zwischen meinen Aussagen und denen von Professor Malik. Innovation kann immer auch in die falsche Richtung gehen, sei dies in der Naturwissenschaft oder im Management. Innovation bedeutet stets auch Risiko. Viele grosse naturwissenschaftliche Innovationen haben sich später als falsch erwiesen. Dennoch sollten wir die Innovationskraft der Naturwissenschaften nicht für die grossen Übel unserer Welt verantwortlich machen. Nicht die Naturwissenschaften, sondern Religionen sowie Wirtschafts- und Geisteswissenschaften haben zu den Kriegen und anderen Krisen des vergangenen Jahrhunderts geführt. Die grossen Bücher von Karl Marx, die kleinen Bücher von Hitler und Mao Tse Tung, die wissenschaftlichen Thesen akademischer Steinzeitkapitalisten sowie – ich muss es sagen – die Bibel und der Koran haben viel mehr Unheil angerichtet als alle naturwissenschaftlichen Erkenntnisse.
Natürlich sind wir Naturwissenschafter dafür mitverantwortlich, dass die Waffen zerstörerischer wurden. Der Anstoss für die falschen politischen Wege, die beschritten worden sind, kam aber nicht von uns. Fast alle grossen Probleme, mit denen wir derzeit kämpfen, sind politische und soziale Probleme, die wir mit Naturwissenschaft und Technik nicht lösen können. Wie gehen wir mit Minderheiten um? Soll die Schweiz die Errichtung von Minaretten zulassen? Wie weit ist der Staat für die gesunde Ernährung seiner Bürger verantwortlich? Solche Fragen stellen selbst eine demokratische und aufgeklärte Gesellschaft vor grosse Zerreissproben. Um sie richtig und innovativ zu beantworten, brauchen wir eine hochqualifizierte, innovative und international denkende Geisteswissenschaft.
Dueblin: Sie haben sich intensiv mit Forschung auseinandergesetzt und waren an vorderster Stelle im Mitochondrium drin. Unter anderem waren sie Mitentdecker von deren Erbmaterial, der mitochondrialen DNS/DNA. Viel tiefer kann man nicht mehr gehen. Wo sehen Sie in der Forschung die ethischen Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen, und wie sollen wir mit diesen Grenzen umgehen?
Prof. Dr. Gottfried Schatz: Meine Antwort auf diese Frage ist gleichzeitig präzise und unpräzise. Jede Generation muss diese Frage in einer demokratischen Konsensfindung selber beantworten. Die Frage beispielsweise, wann man einen Menschen töten darf, konnte bisher nicht für alle Zeiten beantwortet werden. Jede Generation muss sie neu überdenken und beantworten. Solange eine Gesellschaft solche Fragen in einem freien Meinungsbildungsprozess behandeln kann, bin ich optimistisch, dass wir die existierenden Grauzonen bewältigen können.
Gefährlich wird es, wenn die Meinungsbildung von politischen oder finanziellen Mächten manipuliert wird, oder Forschung von privaten Institutionen heimlich und abgenabelt von der Gesellschaft erfolgt. In der Forschung können sich nicht nur die Grenzen des Machbaren, sondern auch die des Erlaubten mit der Zeit verschieben. Deshalb sollte man solche Grenzen nicht für alle Zeiten im Voraus festlegen, sondern sie laufend überdenken und dem neuesten Stand des Wissens und des ethischen Empfindens anpassen. Noch vor zwei Jahrzehnten war es ein Tabu, einem Menschen fremde Gene einzupflanzen. Heute wäre eine grosse Mehrheit wahrscheinlich damit einverstanden, eine genetisch bedingte und tödliche Immunschwäche eines Kindes durch das Einpflanzen eines fremden Gens in das Knochenmark zu heilen. Das Fremdgen darf aber nicht in die Keimzellen der Mutter gebracht werden, weil wir nach heutiger Ansicht kein Recht haben, über zukünftige Generationen zu entscheiden und weil wir die Folgen eines solchen Verfahrens noch nicht genügend genau abschätzen können. Ich bin aber überzeugt, dass wir spätestens in 10 oder 20 Jahren einen solchen Eingriff unter bestimmten Voraussetzungen billigen werden. Sicher wird dies ausschliessen, dass wir unseren Nachkommen blaue Augen oder blonde Haare verschaffen wollen. Ich glaube an eine Kraft in uns Menschen, die hier den richtigen Weg weisen wird.
Dueblin: Es gab in der Wissenschaft verschiedene fundamentale Erkenntnisse. So mussten wir irgendwann erkennen, dass die Erde nicht eine Scheibe ist, sondern eine Kugel. Ebenso mussten wir erkennen, dass nicht die Sonne um die Erde, sondern die Erde um die Sonne kreist. Glauben Sie, dass wir in einigen Jahren zurückblicken und neue allergrösste Irrtümer erkennen werden, denen wir erlegen sind?
Prof. Dr. Gottfried Schatz: Ich bin sehr froh, dass Sie mir diese Frage stellen, denn ich bin überzeugt, dass wir sie mit „ja“ beantworten müssen. Es ist eine der wesentlichsten Leistungen unseres naturwissenschaftlichen Jahrhunderts, das enorme Ausmass unseres Unwissens offen zu legen. Plötzlich wissen wir, dass wir von vielem keine Ahnung haben. Wir wissen nicht, woraus ein grosser Teil des Universums besteht, weil wir die „dunkle Materie“ noch nicht kennen. Wir haben zwar in unserer DNS alle Buchstaben entziffert, verstehen aber nur wenige Prozente von dem, was wir lesen. Wir sprechen von Evolution, kennen aber wahrscheinlich noch nicht alle Kräfte, welche die Evolution treiben. Heute weiss man, dass auch erworbene Eigenschaften manchmal erblich sein können. Einer meiner Kollegen, der amerikanische Astronom Carl Sagan, sagte einmal sehr treffend: „Science is only a candle in a deamon haunted world.“. Ausserdem kommen wir, um auf die Grenzen der Forschung zurück zu kommen, an verschiedenen Punkten bereits an die Grenzen dessen, was wir uns vorstellen können – denken Sie nur an die theoretische Physik. In der Biologie kommen wir diesen Grenzen bereits gefährlich nahe.
Die Komplexität unserer Welt und unseres Körpers ist für uns schlicht nicht vorstellbar. Ich denke, dass wir im Verlaufe dieses Jahrhunderts in mehreren Wissenschaften an solche Grenzen stossen werden, und dass dann Vieles für uns wieder so undurchsichtig wird, wie zu Beginn unserer Forschung. Wir brauchen dann eine neue Art von Intelligenz, um dieses Dickicht der Komplexität zu durchdringen. Tatsächlich sind wir schon auf dem besten Weg, uns mit Hilfe von Computern eine solche Intelligenz zu schaffen. Schon heute können wir ohne Computer über Vieles nicht mehr nachdenken. Wir wissen jedoch nicht, wohin uns diese Intelligenz führen wird. Sie wird dies aber explosionsartig tun – und nicht zu früh. Da das Weltwissen im zeitlichen Verlauf nicht wie eine Parabel, sondern wie eine Hyperbel zunimmt, die plötzlich eine unendliche Steigung erreicht, hat man, nur halb im Scherz, errechnet, dass dieser Zeitpunkt des unendlich schnellen Wissensanstiegs an einem bestimmten Tag in den nächsten Jahrzehnten erreicht werden wird. Unser kollektives Wissen sollte dann unendlich schnell anwachsen. Was dann geschieht, ist völlig offen.
Professor Malik sieht im Interview mit Xecutives.net die Finanzkrise als eine Krise der Bewältigung von Komplexität. Diese treffende Aussage passt sehr gut an diese Stelle. Die Finanzkrise ist ein Beispiel für etwas, das unsere Vorstellungskraft explosionsartig überschritten hat und bei dem wir vielleicht wieder von vorne beginnen müssen.
Dueblin: Erich von Däniken geht im Interview mit Xecutives.net davon aus, dass es im Erbgut der Natur eine Saat gibt, die zu irgendeinem Zeitpunkt, den er nicht nennen kann, aufgehen wird. Was halten Sie persönlich von diesem Gedanken?
Prof. Dr. Gottfried Schatz: Ich teile diese Meinung, bezweifle jedoch, dass eine „Macht“ in uns etwas Konkretes vorprogrammiert hat. Es ist ein Merkmal der lebendigen Materie, dass sie nicht statisch bleiben kann. Sie ist dauernd im Fluss, sie entwickelt sich stetig. Wir wissen aber nicht, wohin sie sich entwickelt. Dass diese Entwicklung einem vorgeplanten Ziel folgt, verneine ich aufgrund dessen, was wir zurzeit wissen, und weil ich kein religiöser Mensch bin. Zu unserer grossen Enttäuschung konnte uns die Naturwissenschaft bisher kein Ziel der Evolution oder unseres Daseins nennen. Damit hat sie uns in eine existentielle Krise gestürzt. Wir treiben in einem System, das von Zufällen bestimmt wird. Weil erworbene Eigenschaften gelegentlich erblich sind, können wir auf unser Geschick ein wenig Einfluss nehmen, doch dieser Einfluss scheint sehr beschränkt zu sein. Wir müssen deswegen für eine Sinnfindung andere Wege suchen, die jenseits von logischem Denken und Wissenschaft beheimatet sind. Wir brauchen auch das „Unlogische“ – den Glauben. Der Fluch ist, dass wir oft das Gleichgewicht zwischen Wissen und Glauben nicht finden. In der heutigen Gesellschaft verschiebt sich der Schwerpunkt in Richtung des Glaubens. Die Resultate sind Intoleranz und Gottesstaaten. Auch eine Tyrannei des logischen Denkens ist gefährlich, da sie schnell zu Kälte und Unmenschlichkeit führt.
Dueblin: Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Schatz, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute bei Ihren Tätigkeiten!
(C) 2009 by Christian Dueblin. Alle Rechte vorbehalten. Anderweitige Publikationen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors gestattet.