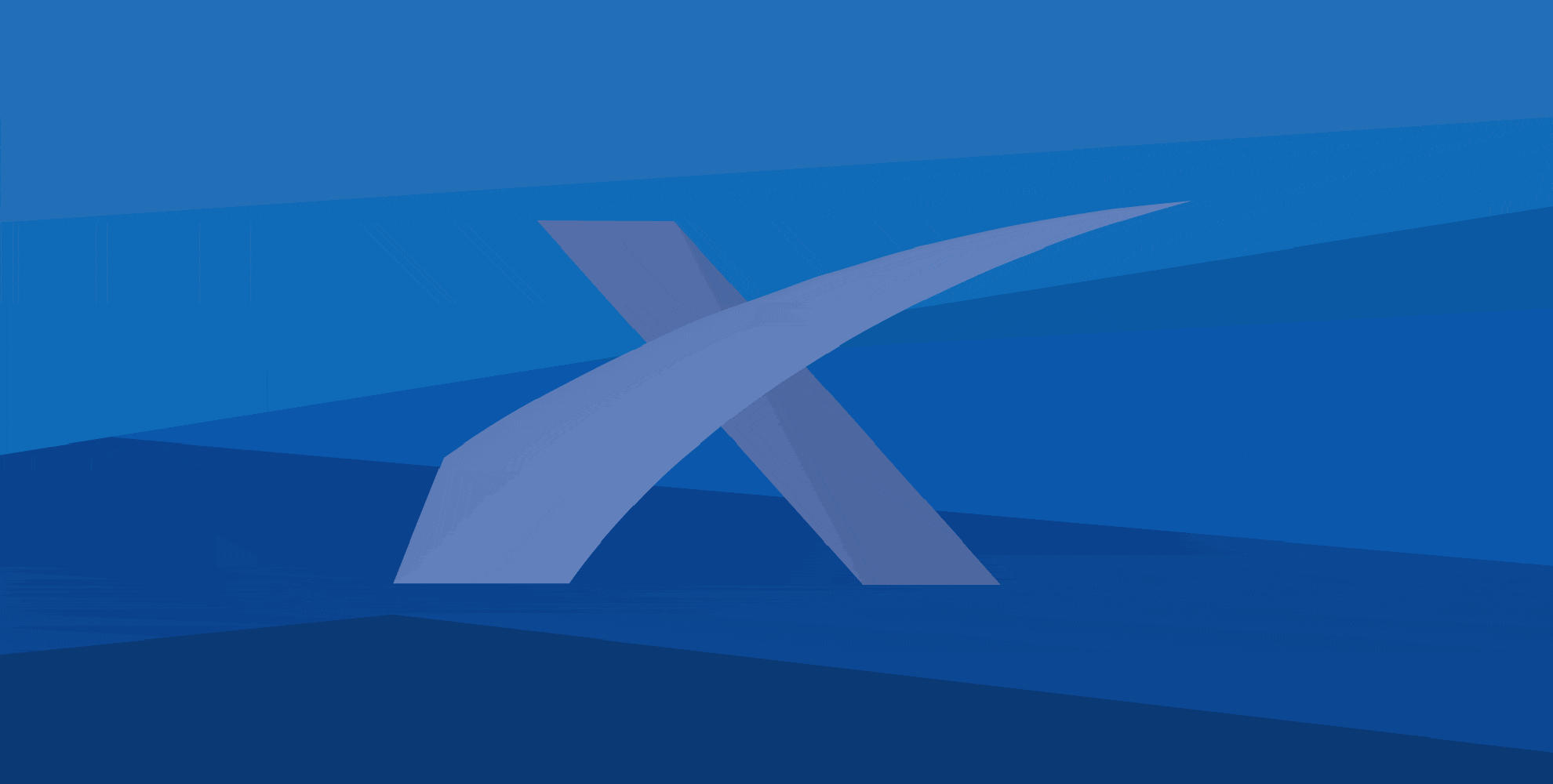Vera Isler-Leiner in Nizza 2009 © E. Widmer
Vera Isler-Leiner, Jahrgang 1931, ist eine Schweizer Kunstschaffende, die international mit ihren Portrait-Fotografien bekannt geworden ist, Bilder, die heute in zahlreichen Museen betrachtet werden können, so im Jahre 2012 auch im Tinguely Museum in Basel. Als kleines Mädchen wurde Vera Isler-Leiner zusammen mit ihren beiden Geschwistern von ihren Eltern aufgrund der nationalsozialistischen Aktivitäten von Berlin in die Schweiz geschickt, wo sie unter schwierigen Bedingungen aufwuchs. Im Jahr 2000 publizierte Vera Isler-Leiner ihre Memoiren „Auch ich“, in denen sie auf eindrückliche und offene Weise über ihren familiären Hintergrund, den II. Weltkrieg und Ihre Jugendzeit in Trogen/Teufen (Appenzell) sowie über ihre Krebserkrankung und ihr Kunstschaffen berichtet, ein Erfahrungsbericht einer Zeitzeugin, der in vielerlei Beziehung zu denken geben muss. Vera Isler-Leiner fing in frühen Jahren an, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, vor allem mit moderner Kunst. Mit ihren Arbeiten über Genetik und Chromosomen („chromos-omen“), die Lesben- und Schwulen-Szene, das Alter und mit der Auseinandersetzung der künstlerischen Aktivitäten in und um AJZ der Achtzigerjahre (es resultierte daraus der Bild-Band „Kunst der Verweigerung“) war sie ihrer Zeit weit voraus und es entstanden erste umfassende Fotografie-Bücher. Während und nach Aufenthalten in den USA begann sie sich zunehmend der Portrait-Fotografie zu widmen. Es entstanden spannende Fotografie-Werke wie beispielsweise „Face to Face“ (Portraits bekannter Kunstschaffender) und „Schaut uns an“ (Porträts von Menschen über 80) mit denen sie sich auch international Anerkennung verschaffte. Im Interview mit Christian Dueblin spricht Vera Isler-Leiner über ihre durch den II. Weltkrieg geprägte Jugendzeit, über ihre Vorliebe für moderne Kunst und gibt Einblicke in das Leben einer versierten und vielseitigen Kunstschaffenden. Sie beschreibt dabei Begegnungen mit spannenden Persönlichkeiten, wie beispielsweise Dennis Hopper und Jasper Jones, die sie fotografieren konnte.
Dueblin: Frau Isler-Leiner, Sie sind 1931 in Berlin geboren und verbrachten den grössten Teil Ihrer Jugendjahre in Trogen und Teufen (Appenzell) in der Schweiz, wo Sie und Ihre beiden Geschwister getrennt von Ihren Eltern schwierige Vorkriegsjahre und schliesslich auch die Kriegszeit verbrachten. Ihre Eltern wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Sie haben 2000 Ihre Memoiren „Auch ich“ veröffentlicht und gerade das Kapitel über Ihre Kinderjahre hat mich sehr berührt. Was kann schlimmeres passieren, als so früh von den Eltern getrennt zu werden, in eine neue nichtvertraute Welt zu kommen und dann nach langem Hoffen schliesslich zu erfahren, dass die Eltern ermordet worden sind und nicht mehr zurückkehren werden. Wie haben Sie diese schwierige Zeit damals in Erinnerung?
Vera Isler-Leiner: Ich verbrachte rund 11 Jahre in Teufen und Trogen (Appenzell), wo mich meine Eltern aufgrund der nationalsozialistischen Tendenzen und Übergriffe auf jüdische Bürger zusammen mit meinen beiden Geschwistern hingebracht hatten. Ich war damals 5 Jahre alt. Meine Eltern waren erfolgreiche Geschäftsleute aus Berlin. Sie hatten Tabakwarengeschäfte und handelten auch mit Pelzen. Wenn man bedenkt, dass die ersten fünf Jahre für ein Kind sehr prägend und wichtig sind, so hat mich all das in einem besonderen Masse beschäftigt. Ich hatte aber, soweit ich mich erinnern kann, eine sehr schöne Frühjugendzeit. Im Gegensatz zu meinen beiden älteren Geschwistern hatte ich aber – und das muss ich wohl als mein Glück im Unglück bezeichnen – nicht alles mitbekommen und manche Zusammenhänge erst später verstanden.
Ich hatte trotz allem Schrecklichen, was mir und meiner Familie zugestossen ist immer ein gutes Selbstbewusstsein. Zuerst waren wir in der Schweiz zahlende Gäste in einer Privatschule, einem Internat für Kinder aus dem Ausland. Meine Eltern hatten anfänglich das Geld, das Internat Sanitas in Teufen zu bezahlen. Im Jahr 1938 aber überschlugen sich die Ereignisse in Berlin. Das Leben vieler jüdischer Familien, so auch meiner, wurde zunehmend unmöglich. Meine Eltern mussten, verfolgt von den Nationalsozialisten, ihre Geschäfte aufgeben und fliehen. Damit konnten sie auch die Schule in der Schweiz, in der ich und meine Geschwister untergebracht waren, nicht mehr bezahlen. Ich erinnere mich an dieses Gefühl des Wechsels von einer bezahlenden Person zu einer nicht mehr zahlenkönnenden Person. Von willkommenen Gästen wurden wir zu geduldeten Menschen, was man uns natürlich auch zu spüren gab und worüber wir uns als Kinder schon bewusst waren. Erst viele Jahrzehnte später, als ich aktiv dem Schicksal und Verbleib meiner Eltern und meiner Familie nachging, wurden mir alle Zusammenhänge klar, die ich damals als kleines Kind noch nicht erkennen konnte. Ich wusste ja bis ich 16 Jahre alt war nicht, dass meine Eltern umgebracht wurden. Ich lebte später in Trogen (Appenzell) immer in der Hoffnung, dass uns unsere Eltern irgendwann abholen würden. Adele, die sechs Jahr älter war als ich, und Judith, die vier Jahr älter war, hatten viel Alltägliches und Schlimmes, was um uns passierte, viel intensiver wahrgenommen als ich. Kaum waren sie der obligatorischen Schulzeit im Internat, in dem wir lebten, entwachsen, mussten sie im Haushalt helfen und man gab ihnen zu verstehen, dass sie für ihre Kosten selber aufkommen müssten. Das war während den Kriegsjahren!

Vera Isler-Leiner: AUCH ICH… ISBN: 978-3897930216
Dueblin: Wer hatte sich denn damals um Sie und Ihre Geschwister gekümmert, als kein Geld mehr von Ihren Eltern aus Deutschland kam, so dass sie überleben konnten?
Vera Isler-Leiner: Die Direktorin der Privatschule, die sich um uns kümmerte, nannten wir später „Tante Daisy“. Ihr richtiger Name war Daisy Markuse. Sie war mit einem russischen Juden verheiratet, der während der russischen Revolution zurück zu seinen Eltern nach Russland ging, nicht mehr zurückkam und sich auch nicht mehr um seine Tochter kümmerte, die mit der Mutter in der Schweiz blieb. Daisy Markuse führte diese Privatschule und setzte sich später dafür ein, dass wir Geschwister nicht getrennt wurden. Die jüdischen Freunde und Bekannten der Ostschweiz hatten die Absicht, uns drei Mädchen auf verschiedene Familien zu verteilen. Keine jüdische Familie war da, die uns alle aufnehmen konnte oder wollte. Tante Daisy war klar, dass, nachdem wir unsere Heimat verlassen mussten, unsere Eltern nicht mehr da waren und wir in einer uns fremden Welt aufwuchsen, nicht auch noch die Geschwister voneinander getrennt werden können. Das hätte sich auf unsere Psyche sicher sehr schlecht ausgewirkt. Sie setzte sich vehement für uns ein, kam in der Folge auch selber für unsere Kosten auf und half uns, die Kriegsjahre zusammen zu überstehen.
Ich ging damals gerne in die Schule. Ich musste ab und zu dem Unterricht fernbleiben, um im grossen Haushalt zu helfen. Meine Eltern kamen anfänglich alle 6 Monate und besuchten uns. Sie kamen nie zusammen, da sich jemand um die Geschäfte kümmern musste.
Das Hauptproblem für mich und meine Schwester bestand im Grunde genommen darin, dass wir schon 1936 in die Schweiz kamen und nicht erst 1939. Wären wir, wie andere Kinder, im Jahr 1939 in die Schweiz gelangt, so wären wir als Kriegsflüchtlinge behandelt worden. So fanden ich und meine Schwestern uns zwischen Stuhl und Bank. Das war für uns sehr schwierig und ich erinnere mich, dass uns bei jedem kleinen Vergehen immer wieder angedroht worden ist, dass man uns ins Waisenhaus bringen würde, eine schreckliche Vorstellung für uns Kinder, die wir ja immer noch glaubten, dass unsere Eltern uns wieder abholen würden.
Dueblin: Sie haben in den letzten Jahren sehr viele Nachforschungen betrieben und beschreiben in Ihren Memoiren, was Ihrer Familie passiert ist. Wo kamen Ihre Eltern ums Leben und was konnten Sie in Bezug auf Ihre Familie und die Kriegsjahre im Nachhinein alles herausfinden?
Vera Isler-Leiner: Meine Eltern sind mit grösster Wahrscheinlichkeit in Polen im Lager Bełżec (Galizien) umgebracht worden. Wir bekamen bis 1942 Briefe aus dem polnischen Krosno, wo sie, unter welchen Umständen auch immer, lebten. Wir haben das nie herausfinden können. 1942 brach der Briefkontakt plötzlich ab. Erst Jahrzehnte später wusste ich von diesen Briefen, die mir meine ältere Schwester bei ihrem Tode durch ihre Tochter aushändigen liess. Sie wollte mich offensichtlich schützen, indem sie mir diese Briefe vorenthielt. Ich musste 70 Jahre alt werden, um sie lesen zu können und mich hat das sehr mitgenommen.
Meine Memoiren sind im Jahr 2000 im Verlag Edition Ost erschienen. Darin berichte ich über meine Jugendzeit, über meine Familie, über meine Zeit als Kunstschaffende, meine Reisen nach New York sowie über meine Krebserkrankung. Die Krebserkrankung habe ich gleichzeitig in Bildern und Fotos visualisiert und es kam zu einer Ausstellung mit dem Titel „Busen und das goldene Kalb“ im Haus am Lützowplatz Berlin. Die Installation provozierte etliche Diskussionsabende von Ärzten aus der Charité. Das Herausbringen des Buches war schwierig aufgrund von Problemen rund um den Verlag. Trotzdem wurde ich eines Tages von einer Person einer Wiedergutmachungsbehörde aus Berlin kontaktiert, die mein Buch offensichtlich gelesen hatte und Informationen über meine Eltern und meine Familie einholen wollte. Erst in der Auseinandersetzung mit dieser Person wurde klar, dass meine Eltern aufgrund der Briefe, die sie gesandt hatten, nicht in Ausschwitz, was ich und meine Geschwister jahrzehntelang glaubten, sondern im polnischen Bełżec ermordet wurden. Drei Jahre nach meinem Buch „Auch ich“ setzte ich 2003 erstmals meinen Fuss auf polnische Erde. Ich fuhr nach Ausschwitz und nach Bełżec, um mir vor Ort ein Bild zu machen. Es entstand das Video „Where are the ashes of my parents?“.

Vera Isler-Leiner: Chromosome © Vera Isler-Leiner
Dueblin: Sie haben trotz allen Widrigkeiten in Ihrer Jugendzeit später den Einstieg ins Berufsleben erfolgreich geschafft, eine Familie gegründet und sind zu einer anerkannten Künstlerin avanciert, die in vielen Museen ausstellt. Wie hat sich Ihre Vergangenheit auf Ihre Kunst ausgewirkt?
Vera Isler-Leiner: Diese Einflüsse meiner Vergangenheit auf mein Kunstschaffen gibt es nicht. Ich war schon als kleines Kind gut im Zeichnen und Basteln und erinnere mich, dass ich mangels Geld einfach Geschenke für andere Menschen machte. Ich war damals kurz nach Kriegsende überzeugt, dass meine Eltern jeden Tag auftauchen und uns wieder nach Hause bringen würden. Ich bekam mit, dass viele Menschen aus Sibirien und aus ihrer Kriegsgefangenschaft nach Hause kamen und war überzeugt, dass auch meine Eltern zurückkommen würden.
Dueblin: Sie waren und sind sehr vielfältig künstlerisch tätig. Insbesondere die frühe Auseinandersetzung mit dem Thema Genetik und Chromosomen könnte darauf schliessen lassen, dass Sie damit auch ihre Vergangenheit bewältigen: „Mutation“, „Manipulation“ und „Frustration“ könnten auf die Geschehnisse im II. Weltkrieg hinweisen: Vernichtung und Elend waren bekannte Konsequenzen des Krieges. Steckt in Ihrer Kunst die Verarbeitung Ihrer Jugend und des Schicksals Ihrer Eltern nicht doch irgendwo mit drin?
Vera Isler-Leiner: Nein, das glaube ich nicht. Ich lebe nicht in der Vergangenheit und bin immer im Jetzt, auch heute immer noch neugierig auf alles. Ich arbeitete konkret und setzte mich mit vielen verschiedenen Kunsthemen auseinandergesetzt. Im von Ihnen erwähnten Triptychon habe ich mich mit dem Thema Genetik auseinander. Im Triptychon behandle ich die Mutation, die von der Natur gelenkt wird, die Manipulation, wo die Menschen Einfluss in die Geschicke der Natur nehmen (wollen), dann folgt die Frustration. Die Frustration war für mich damals Ausdruck für die Probleme, welche die Genetik mit sich bringen würde, aber sie ist auch eine Metapher für den Kunstbetrieb, dem ich immer sehr kritisch gegenüber eingestellt war. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Genetik und Chromosomen hat nichts mit meiner Vergangenheit zu tun. Ich bin mehr durch Zufall auf dieses Thema gestossen. Grund war die Tatsache, dass ich in einem Labor arbeitete und per Zufall freiwillig einer Forscherin half, Chromosomen unter dem Mikroskop zu zählen. Aufgrund dieser mehr technischen Auseinandersetzung mit diesen biologischen Lebensgrundlagen kamen bei mir Fragen auf und ich wollte mehr wissen. Ich erkundigte mich, fragte den Nobelpreisträger Professor Werner Arber und begann, Chromomen grossformatig dreidimensional nachzubilden. Ich fing an, mich selber in Sachen Genetik weiterzubilden, um die Chromosomen zu visualisieren. Mein Ziel war es, die Gesellschaft, die über dieses Thema damals noch überhaupt nicht informiert war, zu sensibilisieren. Ich war der Zeit wohl um rund 10 Jahre voraus. Viele Menschen verstanden nicht, was ich ausdrücken wollte und das Thema Genetik wurde erst später brisant und aktuell.
Dueblin: In New York 1980 fingen Sie auch an, Menschen zu fotografieren und es entstand später das fotografische Werk „Face to Face I“ und „Face to Face II“, eine Sammlung von Portraits bekannter Künstlerinnen und Künstler. Wie kamen Sie zur Fotokunst?
Vera Isler-Leiner: Ich hatte schon immer gewusst, wie eine Kamera funktioniert, weil ich vorher schon meine Teppiche, serielle Reliefs und Bleibilder aufgenommen hatte. Ich habe das Meiste selber gelernt. In Fotografie-Kursen fühlte ich mich nicht wohl. Kurse beispielsweise über das Entwickeln von Fotos fühlten sich für mich immer etwas seltsam an und die Reaktionen von Kursteilnehmern waren nicht immer positiv. Man dachte sich wohl, warum eine Frau und Künstlerin, die schon Fotografie-Wettbewerbe gewonnen hat, denn noch einen Kurs im Entwickeln von Fotos besuche müsse.
Nebst meiner autodidaktischen Vorgehensweise beim Fotografieren hat mir beim Entwickeln und Printen von Bildern der Fotograf Hugo Jäggi sehr geholfen. Ich arbeitete Tag und Nacht und wurde ein wirklicher Workaholic. Es bedurfte einiger Jahre Arbeit, bis ich auch auf dem Kunstmarkt ankam und von meinen künstlerischen Einkünften leben konnte.

Luise Bourgeois. Mit freundlicher Genehmigung von Vera Isler-Leiner © Vera Isler-Leiner
Dueblin: Was haben Sie in den USA anfänglich fotografiert?
Vera Isler-Leiner: In den USA fing ich an, Gay People, also Lesben und Schwule, zu fotografieren. Viele Menschen rieten mir damals, die Hände von diesen Menschen zu lassen. Ich liess mich aber nicht beirren und folgte meinen Interessen und meinem Bauchgefühl. Später in der Schweiz war für mich die rebellierende Jugend aktuell. Das AJZ (Autonomes Jugendzentrum) entstand als Buch mit dem Titel „Kunst der Verweigerung“. Danach kam das Altenbuch „Schaut uns an“ (Porträts von Menschen über 80). Das Thema Alter war damals noch nicht aktuell und ich war auch mit diesem Buch der Zeit 10 Jahre voraus, was die Ablehnung dem Projekt gegenüber so vieler Verleger deutlich zeigte. Das Buch wurde aber schliesslich ein Foto-Hit, den man als meinen fotografischen Durchbruch ansehen darf. Innerhalb von drei Monaten wurden 3‘000 Bücher verkauft.
Nachdem ich mich mit der Jugend und dem Alter auseinandergesetzt hatte, interessierte ich mich für den Arbeitstitel „Mittelalter“. Es entstand das Buch mit dem Titel „Spitzen-Plätze – Arbeitsplätze von Spitzenkräften“. Ich wollte die Arbeitsplätze ambitionierter erfolgreicher Menschen mit Bildern einfangen. Das Projekt erweiterte sich in verschiedene Richtungen. Ich arbeitete mit Menschen wie Harald Szeemann, Michael Ringier, Maurice Béjart, Fritz Leutwiler und dem Nobelpreisträger Karl Alex Müller, um nur einige zu nennen. Auch sie fotografierte ich in ihrem eigenen Umfeld.
Dueblin: Wie kam es später zu den Portrait-Fotografien international sehr bekannter Persönlichkeiten, vor allem den Bildern in Ihren Werken „Face to Face“?
Vera Isler-Leiner: Ich habe mich sehr mit der modernen Kunst auseinandergesetzt und war regelmässig Gast beispielsweise in der Galerie Kornfeld in Bern. Kornfeld hatte immer sehr moderne Künstler gezeigt. Ich lernte dort die Kunstwerke von Luginbühl, Tinguely, Sam Francis und vieler anderer Künstlerinnen und Künstler kennen. Ich wusste sehr genau, was ein Serra und ein Christo machten. Mich hat damals das Aktuelle sehr interessiert. Ich machte in der Folge zahlreiche Bildbände mit meinen Fotos, die veröffentlicht wurden. Das bekannteste ist sicher das von Ihnen genannte Face to Face I und II. Die Werke dieser Künstler haben mir sehr gefallen und ich hatte immer das Bedürfnis, mehr über die Künstler selber zu erfahren und sie auch persönlich kennenzulernen.
Dueblin: Wie haben Sie damals Künstlerinnen und Künstler, darunter beispielsweise ein Josef Beuys oder ein Dennis Hopper, ausgewählt, sprich was war Ihnen wichtig, wenn Sie jemanden fotografieren wollten und wie sind Sie mit diesen bekannten Menschen in Kontakt gekommen?
Vera Isler-Leiner: Ich ging die Künstlerinnen und Künstler immer telefonisch an und teilte mit, dass ich sie gerne fotografieren wollte. Im Ausland ging das immer sehr gut. Ich bekam selten Absagen. Ich habe mich immer wieder erkundigt, wo sich die Künstler aufhielten. Etliche Künstler konnte ich in Basel fotografieren. Irgendwann hatte ich auch einen Presseausweis und das erleichterte mir die Arbeit. Dennis Hopper beispielsweise hatte eine Pressekonferenz in Basel gegeben und sich auf meine spontane Anfrage hin für ein Fotoshooting zur Verfügung gestellt. Die Arbeit mit ihm war super und er selbst ist ein guter Fotograf.

Dennis Hopper. Mit freundlicher Genehmigung von Vera Isler-Leiner © Vera Isler-Leiner
Dueblin: Sie haben nebst Dennis Hopper viele andere Fotografen und Fotografinnen fotografiert, so beispielsweise auch die Fotografie-Legende Richard Avedon. Wie gingen Sie an diese Menschen als Fotografin ran, die allerhöchste Ansprüche an die Fotografie haben und hatten?
Vera Isler-Leiner: Ja, das war nicht immer ganz einfach. Aber ich habe auch diese Menschen nie als höher oder besser gestellt betrachtet und behandelt. Ich bin ihnen auf einer menschlichen Ebene begegnet und bin nie „niedergekniet“. Ich glaube, dass meine Gegenüber meine Einstellung sehr geschätzt haben. Es war mir auch vollkommen egal, ob gewisse Künstler sehr viel Geld verdienten oder nicht. Mich interessierte der Mensch und das Festhalten eines Augenblicks. Ich wollte mit Hilfe der Fotografie immer zeigen, wer die Menschen, die vor meiner Linse standen, sind. Mir war eine intime Atmosphäre wichtig. Ich habe deshalb nie jemanden zu Foto-Shootings mitgenommen, keine Assistenten waren dabei. Das haben auch die Künstler und Künstlerinnen sehr geschätzt. Für die Schwarz-Weiss-Fotografie habe ich mich entschieden, weil diese Art der Fotografie für mich etwas Zeitloses hat.
Dueblin: Hatten Sie nach den Fotoshootings noch Kontakt mit den von Ihnen fotografierten Menschen?
Vera Isler-Leiner: Ich habe allen Menschen, die ich fotografiert hatte, Abzüge zukommen lassen. Das haben sie sehr geschätzt und manchmal kam es dann auch noch zu weiteren Begegnungen. Ich war eine Vorwärtsstürmerin und habe nie Anzeichen gegeben, noch weiteren Kontakt haben zu wollen. Die vielen von mir fotografierten Menschen waren schon damals sehr begehrt, oft Stars, und man durfte bei manchen froh sein, überhaupt ein „rendez-vous“ zu erhalten. Aber es gab auch Ausnahmen. Jasper Jones habe ich mehrere Male getroffen. Ich musste ihn zuerst einige Male anrufen und eine Sekretärin meinte an einem Freitag, er würde am Montag nach Europa fliegen und hätte keine Zeit. Ich hatte die private Nummer von Jasper Jones, rief ihn an und bot ihm an, am Samstag oder Sonntag vorbeizukommen. Er war sehr aufgeschlossen und lud mich für den Sonntagmorgen in sein Haus ein. Es wurde damals gerade renoviert und war eingepackt, ähnlich einem eingepackten Gebäude von Christo. Er machte die Türe auf und bat mich in sein Haus. Das Haus war nicht sehr gut beleuchtet und das erschwerte meine Arbeit und fotografischen Absichten. Nur in einem Untergeschoss kam etwas Licht ins Haus, das mir geeignet schien. Ich sah dort auch sein ganz bekanntes Bild mit den Sternen und der amerikanischen Flagge. Ich bat ihn, dieses Bild neben sich zu stellen, worauf er sagte, dass ihm das Bild nicht mehr gehören und es sehr viel Geld kosten würde. Er nahm das Bild aber trotzdem, stellte es neben sich und ich fing an zu fotografieren. Später, als ich wieder in New York war, hatte ich ihm Kopien gegeben und wir tranken zusammen Kaffee. Er hat das sehr geschätzt und mir viel von sich und seiner Arbeit erzählt.
Dueblin: Sie werden in Kürze 82 Jahre alt und haben eine interessante künstlerische Karriere und ein spannendes Leben auf das Sie zurückblicken können. Was sind Ihre nächsten Pläne?
Vera Isler-Leiner: Ich habe mich nie nur auf einer künstlerischen Linie bewegt, wie das viele andere Künstlerinnen und Künstler tun. Wenn Sie auf mein Schaffenswerk zurückblicken, so können Sie erkennen, dass ich mich von einem Jahrzehnt zum anderen verschiedenen Tätigkeiten zugewendet habe. Die Abwechslung und die Auseinandersetzung mit der bildenden Kunst, der Malerei oder beispielsweise der Fotografie haben mich sehr interessiert und ich konnte meinen künstlerischen Horizont erweitern. Das Kästchendenken sagt mir auch heute nicht zu. Das hat rückblickend aber nicht nur Vorteile. Um auch auf dem Markt als Künstler erfolgreich zu sein, sind eine gewisse Stetigkeit und das Arbeiten in einem „Kästchen“ von Vorteil. Künstler, die ihr Leben lang das Gleiche oder Ähnliches gemacht haben, sind oft auch in finanzieller Hinsicht erfolgreicher, als Künstler, die sich verschiedenen Themen widmen und die man immer wieder von neuem verstehen muss. Ich habe sehr viel gemacht und geschaffen, das vom Publikum gar nie wahrgenommen worden ist. Zurzeit bin ich daran, auch auf meine anderen Kunstwerke und Arbeiten aufmerksam zu machen.

Jasper Jones. Mit freundlicher Genehmigung von Vera Isler-Leiner © Vera Isler-Leiner
Dueblin: Frau Isler-Leiner, was wünschen Sie sich selber und für die Kunst für die Zukunft?
Vera Isler-Leiner: Ich wünsche der Kunst, dass jeder die Möglichkeit hat, der sich künstlerisch betätigt, wahrgenommen zu werden. Das ist heute nicht einfach. Viele Kunstwerke werden heute wie Aktien gehandelt. Es gibt Investorengruppen, die mit Grossankäufen ganze Galerien aufkaufen und an der ART Basel im grossen Stil Kunst einkaufen, nur mit der Absicht und Hoffnung, dass die Kunstgegenstände wie Aktien im Wert steigen werden. Gekauft wird vor allem teure Kunst, was dazu führt, dass Menschen, die in anderen Preissegmenten Kunst anbieten, ins Abseits geraten und schlicht ausgeschlossen werden. Die Auseinandersetzung mit Kunst findet nur noch insofern statt, als solche Menschen Renditen erzielen wollen. Den tieferen Sinn und die Entstehung von Kunst erkennen sie sicher nicht mehr. Das ist keine gute Entwicklung. Kleinere Künstler und Galerien können hier nicht mithalten und laufen Gefahr, unterzugehen, bevor sie sich überhaupt entfalten können. Es ist ebenfalls bezeichnend, dass sich viele Menschen offenbar erst für Kunst interessieren, wenn sie schon bekannt ist. Auch diese Verhaltensweise finde ich nicht gut. Gute Kunst ist nicht einfach plötzlich da, kostet viel Geld und kann gekauft werden. Hinter jeder Kunst und hinter jedem Künstler steckt eine Geschichte und jeder sollte eine Chance und gebührend Aufmerksamkeit bekommen. Zudem sehe ich, wie wenige Frauen in unseren Museen vertreten sind. Auch das sind Zeichen, dass wir noch umdenken müssen. Gerade für (angehende) Künstlerinnen gibt es also noch viel zu tun und zu bewirken.
Und in Bezug auf mich (lacht): Am liebsten mache ich gar keine Pläne mehr und lasse die Dinge einfach auf mich zukommen. Es wäre schön, wenn man auch meine anderen Fotografien und Werke zur Kenntnis nehmen würde. Face to Face I und Face to Face II sind nur eine Schublade und nur ein kleiner Teil meiner fotografischen und künstlerischen Arbeit.
Dueblin: Liebe Frau Isler-Leiner, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen viel Gesundheit und mit Ihren künstlerischen Projekten weiterhin viel Erfolg!
(C) 2013 by Christian Dueblin. Alle Rechte vorbehalten. Anderweitige Publikationen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors gestattet.
______________________________
Links
– Homepage
– Wikipedia
– Übersicht der Publikationen