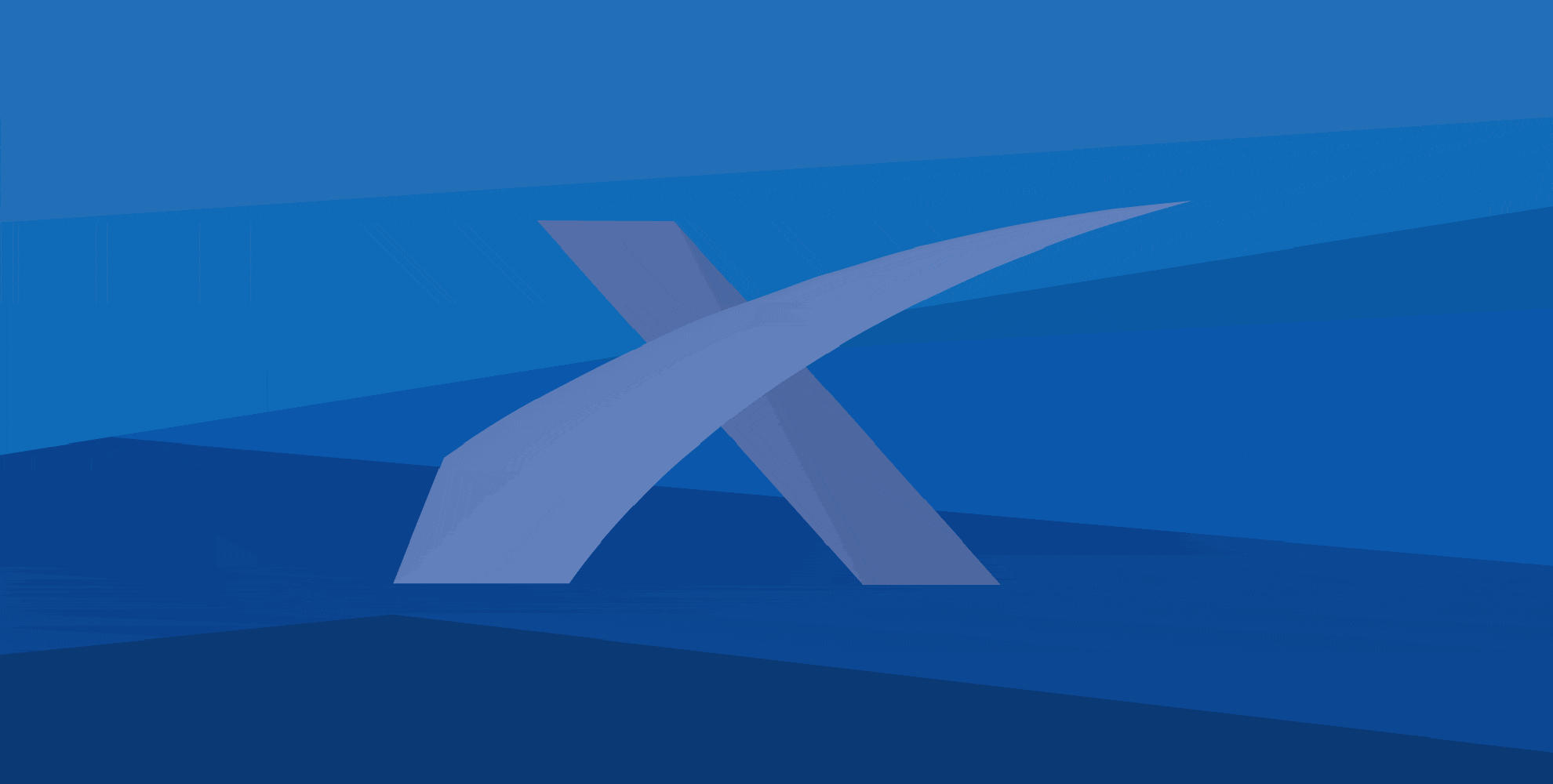Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Borner
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Borner studierte Biologie an der Universität Basel, wo er im Jahr 1988 promovierte. Es folgten Arbeits- und Forschungsaufenthalte an der Columbia University am Comprehensive Cancer Center in New York und an der Universität Lausanne am Institut für Biochemie in Epalinges. Von 1993 bis 2000 arbeitete er als Assistenzprofessor an der Universität Fribourg am Biochemischen Institut, wo er 1998 auf dem Gebiet der Biochemie auch habilitierte. Der mit vielen Preisen und Würden ausgezeichnete Forscher ist seit 2000 an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg i.Br. tätig, am Institut für Molekulare Medizin und Zellforschung des Zentrums für Biochemie und Molekulare Zellforschung (ZBMZ), seit 2006 als ordentlicher Professor. Im Interview mit Christian Dueblin spricht Professor Borner über seinen Studien- und Forschungsweg und das Leben eines Forschers. Er berichtet über sein Spezialgebiet, den Zelltod, nach dessen Ursachen er seit vielen Jahren zusammen mit seinem Team forscht und über dessen biologische Zusammenhänge er publiziert und doziert. Borner zeigt auf, was der Tod aus biologischer und chemischer Sicht bedeutet, was er der Natur für einen Nutzen bringt und zeigt, wohin die Forschung rund um das Absterben und Ersetzen von Zellen in unserer Gesellschaft führen könnte: Die Möglichkeit, Leben mit genetisch-technischen Mitteln und Eingriffen zu verlängern, schliesst Borner nicht aus und er beschreibt einen Gang zum Arzt in 30 Jahren.
Xecutives.net: Professor Borner, Sie gehören zu den Schweizer Forschern, die an der Spitze des technisch Möglichen auf der ganzen Welt geforscht haben und nach wie vor forschen. Generell auf Ihre Forschungskarriere zurückblickend, wie beurteilen Sie heute Ihren Lebensweg als Forscher? Wer und was hat Sie gefördert und wo hatten Sie Hürden zu überwinden, die Sie geprägt haben?
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Borner: Was mich in meiner Karriere sehr viel weiter gebracht hat, waren Menschen, die mich als Mensch und als Forscher gleichermassen begleitet haben. Den Weg des Forschers kann man nur gehen, wenn man Lehrer, Professoren und Mentoren hat, die einen für ein Fach begeistern und in einem das zum Forschen nötige „Feu sacré“ entzünden helfen. Ohne dieses Feu sacré ist eine Forscherkarriere, wie ich sie durchlaufen habe, wohl eher nicht möglich. Die Mentoren helfen einem nicht nur, das richtige Forschungsthema zu finden, sie machen die jungen angehenden Forscher auch auf mögliche, mit der Forschertätigkeit verbundene, Berufe aufmerksam und helfen, gewisse Türen weltweit geöffnet zu bekommen, die für die Entwicklung als Forscher wichtig sind. Mir fällt heute auf, weil ich selber seit vielen Jahren Doktorandinnen und Doktoranden an meinem Institut und in meiner Doktorandenschule in Freiburg i.Br. betreue, wie wichtig es ist, mit ihnen die richtigen Forschungsthemen zu finden, ihnen aber auch frühzeitig aufzuzeigen, was ein Forschungsthema oder ein Weg, den man einschlägt, für berufliche Perspektiven bietet, oder eben auch nicht.
Xecutives.net: Es sind zweifelsohne auch forschungstechnische Fragen, die wichtig sind. Wie steht es aber mit der Familie, die in berufliche Entscheide als Forscher besonders miteinbezogen werden muss? Immerhin sind die meisten erfolgreichen Forscher jahrelang im Ausland tätig, um sich Erkenntnisse aneignen zu können.
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Borner: Das ist eine eminent wichtige Frage, die jeden Forscher auf der Welt beschäftigt und es gibt keine Antwort, die für alle befriedigend ausfallen könnte. Zurück aus New York und mit meinem Postdoc in der Tasche kam tatsächlich die Frage der Familie hinzu. Ich konnte damals nicht einfach das tun, was ich in Sachen Forschung wirklich tun wollte und hätte tun können. In New York, in der Krebsforschung tätig, beschäftigte ich mich mit dem Analysieren von Brustkrebszelllinien und Proteinkinasen. Dieses Feld war weitgehend unbekannt und ich fand zurück in der Schweiz keine Forschergruppe, in der ich mich hätte entfalten und die ich hätte unterstützen können. Ich stand also schon bald wieder vor dem Entscheid, erneut ins Ausland zu gehen oder ein neues Forschungsgebiet zu finden. Ich entschied mich für den zweiten Weg, also für den Wechsel meines Spezialgebietes – aus familiären Gründen. Dieser Entscheid war für mich nicht ganz einfach, da ich durch meine Forschertätigkeit in Sachen Brustkrebs bereits über ein sehr gutes und weltweit funktionierendes Netzwerk verfügte. Ich fing eigentlich wieder von Null an. Es war im Nachhinein gesehen aber der richtige Entscheid. Er lehrte mich auch, mit Ups und Downs umgehen zu können, mit denen man als Forscher immer konfrontiert ist.
Xecutives.net: Seit Jahren erforschen Sie den Zelltod und haben viel über dieses Thema publiziert. Auch sind Sie regelmässig auf Vortragsreisen und erklären vor allem auch einem jüngeren Publikum biologische Zusammenhänge, eben auch in Bezug auf den Zelltod, den Tod und eine gesunde Lebensführung. Wie kamen Sie zum Forschungsthema „Zelltod“?
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Borner: Ich bin durch Zufall auf das Thema Zelltod aufmerksam geworden. Ich hatte schon während meiner Postdoc-Zeit in New York sterbende Zellen unter dem Mikroskop gesehen. Aber damals steckte die Erforschung des Zelltodes noch in den Kinderschuhen und man wusste noch nicht, dass für den Entscheid, ob eine Zelle lebt oder stirbt, spezielle Moleküle wichtig sind. Ich hatte mich auf eine Assistenzprofessur in Manitoba (Kanada) beworben, wo damals schon auf dem Gebiet des Zelltodes geforscht wurde, nahm aber letztendlich die Stelle nicht an, weil ich aus familiären Gründen in die Schweiz zurückkehren wollte. Interessanterweise fand ich dann dort genau das, was ich in Manitoba machen wollte, eine Arbeit auf dem Gebiet des Zelltodes. Es handelt sich beim Thema Zelltod um ein sehr grosses und spannendes Gebiet, auf dem vieles noch nicht klar und erforscht ist. Ich trat eine neue Postdoc-Stelle in Lausanne an, forschte auf einem Protein, das damals noch unbekannt war, legte mich ins Zeug und publizierte sehr viel.
Xecutives.net: Haben Sie sich nie überlegt, in die Privatindustrie zu wechseln und in einem international tätigen Pharma-Unternehmen an neuen Medikamenten zu forschen?
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Borner: Es war mir immer wichtig, irgendwann eine eigene Forschergruppe leiten zu können, aber auch Professor zu werden. Eine Karriere in der Industrie kam für mich nicht in Frage, weil ich einer Lehrtätigkeit nachgehen wollte, eine Berufung, die ich schon seit meiner Jugendzeit verspüre. Ich arbeite sehr gerne mit Doktoranden zusammen und es ist mir wichtig, sie umfassend zu unterstützen. Ich fing in Lausanne an zu forschen und bekam drei Jahre später eine Juniorprofessur (damals noch START genannt) des Nationalfonds. Ich fand in der Université de Fribourg eine gute Partnerin und konnte dort am Institut für Biochemie tätig werden. Mit Hilfe von weiteren Nationalfonds- und Krebsforschungsgeldern konnte ich von 1993-2000 eine spannende Sache aufbauen und ausgiebig forschen. Das war eine sehr interessante Erfahrung, denn es ging nicht mehr darum, nur in einem Biotop zu arbeiten, in dem einem der Chef sagt, was es zu tun gilt, sondern darum, selber einen Forschungsplatz, eigentlich einen eigenen Betrieb, aufzubauen. Mit viel learning-by-doing schaffte ich es, ein spannendes Projekt abzuschliessen. In dieser Zeit konnte ich viel publizieren. Von Fribourg ging es dann schon bald nach Freiburg i.Br., wo ich auch heute noch tätig bin.
Xecutives.net: Ihr Kollege Professor Gottfried Schatz hat im Interview berichtet, wie schwierig es ist, die besten Forscherinnen und Forscher zu finden und auszuwählen. Gute Forscher seien Menschen, die sähen, was die meisten auch sehen, aber noch keiner gedacht habe, meinte er.
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Borner: Das ist eine wichtige Erkenntnis und sie ist mit sehr viel Erfahrung verknüpft, über die Gottfried Schatz wie kein Zweiter verfügt. Es ist ein langer Prozess, selber erkennen zu können, ob man zu diesen „sehenden“ Personen gehört. Das lässt sich in der Phase der Dissertation oft noch nicht abschätzen. Das eigene Denken entwickelt sich erst, wenn man selber unabhängig tätig sein kann und nicht mehr nur fremdbestimmt ist. Und tatsächlich sind diejenigen Menschen, die eine andere Sicht der Dinge haben, diejenigen, die oft sensationelle Forschungsresultate erzielen. Was Schatz meint, ist, das richtige Gespür zu haben für die biologischen Zusammenhänge und Probleme und Herausforderungen aus einem ganz andern Blickwinkel betrachten und angehen zu können. Wir Forscher decken ja nur auf, was in der Natur bereits existiert. Oft sind diese Zusammenhänge enorm komplex.
Xecutives.net: Professor Hans Peter Beck, Schweizer Physiker, der seit vielen Jahren am CERN forscht und Wesentliches zur Bestätigung des Higgs-Teilchens beigetragen hat, machte im Interview darauf aufmerksam, dass die Erkenntnis, dass gewisse physikalische Modelle, die man erforscht hat und nicht stimmen, für die Physik prägend sei. Es ginge immer wieder darum, neue Modelle auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen und je nachdem halt alte zu verwerfen oder neu zu entwickeln. Wie geht der Biologe und Biochemiker damit um, wenn er nach langer Forschertätigkeit in einer Sackgasse landet und was hat diese Sackgasse für einen Stellenwert in der Forscherkarriere?
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Borner: Das Scheitern beim Forschen ist ein sehr wichtiger Punkt, eine Erkenntnis, die das Forscherleben ebenfalls beeinflusst und leider nur auf wenig Anerkennung stösst. Betrachtet man die Literatur, treffen Sie dort vorwiegend auf diejenigen Personen, die Neues gefunden haben, Dinge, die die Welt bewegen. Zusammenhänge und Erkenntnisse, die aufzeigen, dass etwas nicht weiterführt oder eben nicht funktioniert, sind weit weniger „sexy“ und stossen auf wenig Anerkennung, obwohl diese Erkenntnisse ebenfalls von grösstem Wert wären. Das ist eine schlechte Entwicklung und es steht hier in der Forschung nicht anders als in vielen andern Lebensbereichen.
Die Wissenschaft ist ein stetes „Sichherantasten“, ein konstantes Umgehen mit Scheitern und Erfolg. Man ist dauernd dem Risiko ausgesetzt, einen falschen Weg eingeschlagen zu haben. Diese falschen Wege sollten ebenfalls mitgeteilt und publiziert werden. Da dem viel zu wenig der Fall ist, wird heute immer wieder Forschung auf Gebieten betrieben, die in eine Sackgasse führt, was sich in vielen Fällen verhindern liesse, wüssten andere Forscher über die gescheiterten Projekte.
Xecutives.net: Somit unterscheidet sich das Leben eines Forschers nur wenig von anderen Berufen und das Abenteuerliche, das mit diesem Beruf für viele Menschen mitschwingt, ist eher ein Mythos?
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Borner: Ja, es wäre naiv zu denken, dass die Forschung anders funktioniert als die restliche Welt. Wir erkennen das bei den Medien und in der Politik. Um sich Gehör verschaffen zu können, müssen immer extremere Mittel angewandt werden, um die Aufmerksamkeit des Publikums gewinnen zu können. In der Forschung verhält es sich nicht anders. Es zählt der Erfolg! Damit kommt man zu Geld, wird an Konferenzen eingeladen und erhält Preise. Mit diesem Business muss ein Forscher zurechtkommen und manch ein Forscher schreckt darum umso mehr davor zurück, interessante Forschungsresultate zu veröffentlichen, die diesen Massstäben nicht gerecht werden.
Xecutives.net: Gottfried Schatz hat im Interview zudem darauf aufmerksam gemacht, dass es interessant zu beobachten sei, dass niemand Zweifel daran hat, dass ein Sportler immer daran denken muss, der beste zu sein, um erfolgreich sein zu können. In der Forschung ist diese Denke offenbar weniger klar, was das Risiko, ganz vorne nicht mit dabei sein zu können, erheblich erhöht?
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Borner: Auch das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Jeder möchte etwas herausfinden, was noch niemand vor ihm herausgefunden hat und der Menschheit und Gesellschaft dient. Das kann bspw. ein neues Medikament sein. Es muss das Ziel jedes Forschers sein, das Beste aus seiner Forschungstätigkeit herauszuholen. Geht es um ein neues Medikament, um bspw. Brustkrebs zu bekämpfen, so muss jeder versuchen, einfach der Beste zu sein, am richtigen Protein zu arbeiten und die richtigen Zusammenhänge herauszufinden. Hier spielt die Intuition eine enorme Rolle, aber auch das Umfeld, in dem man tätig sein kann. Und schliesslich darf der Zufall nicht unterschätzt werden. Denken Sie an die sogenannten „Garbage Experiments“. Ein Forscher schmeisst eine Forschungsidee in den Kübel, von der er denkt, dass sie gescheitert ist. Der Student findet die verworfene Idee und stellt fest, dass sie auf einem ganz anderen Gebiet innerhalb völlig anderer Zusammenhänge eine Lösung darstellt…
Xecutives.net: …also ähnlich, wie etwa die Wirkung des Penizillins erkannt wurde?
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Borner: Genau! Und schauen Sie, wie oft man sich als Forscher fragt, wenn man eine neue weltbewegende Studie liest, warum man denn um Gotteswillen nicht selber auf diese Idee gekommen ist (lacht). Was Gottfried Schatz mit seiner Aussage aber auch ausdrücken will, ist, dass es nicht nur auf den Einzelnen ankommt, sondern eine Universität oder ein ganzes Land die richtigen Forschungsvoraussetzungen schaffen muss, damit diese Einzelnen ihre Resultate überhaupt erzielen können. Will ein Land die besten Tennisspieler haben, braucht es heute nicht viel Überzeugungsarbeit, um dem Laien klar zu machen, dass man geeignete Tennisplätze bauen muss. Das gilt auch für die Forschung, die ohne eine geeignete Infrastruktur nicht funktioniert.
Der Team-Gedanke ist ebenfalls sehr wichtig. Es gilt die richtigen Menschen zu finden, mit denen man forschen will. Viele Projekte sind zudem dermassen gross und komplex, dass eine Person allein gar keine Chance hätte, etwas herausfinden zu können. Sie haben das CERN genannt und Professor Hans Peter Beck, der dort ganz vorne mitforscht. An den weltbewegenden Projekten am CERN arbeiten nicht selten mehrere Hundert Spezialisten, mit Gerätschaften, die Hunderte von Millionen Franken kosten. Ein Beispiel in Sachen Biologie sind Hochleistungsmikroskope, die von mehreren Forschern oder ganzen Forscherteams benutzt werden, weil deren Beschaffung sehr teuer ist.
Xecutives.net: Sie setzen sich seit Jahren Ihrer Forschungstätigkeit mit dem Zelltod auseinander. Der Tod ist eine Sache, die in unserer Gesellschaft gerne ausgeklammert wird. Wir sprechen ungern über ihn. Zelltod und Tod sind, was ihren natürlichen Sinn anbelangt, nicht das Gleiche. Was heisst Zelltod und was bedeutet dieser von der Natur vorgegebene Mechanismus für das Leben ganz allgemein?
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Borner: Der Zelltod und der Tod eines ganzen Organismus‘ hängen tatsächlich nur zum Teil miteinander zusammen. Der Tod ist eine eher unangenehme Angelegenheit. In unserer modernen Gesellschaft sowieso, hier wird er weitgehend verdrängt. Wir haben ja bereits schon mit dem Altern Probleme. Der Zelltod ist beschränkt auf eine Zelle, die Sterben muss. Sie wird eliminiert, weil krank und nicht mehr funktionsfähig. Die Zelle stirbt ab und sie wird ersetzt. Dahinter steckt ein enorm komplizierter Mechanismus, über den wir noch nicht alles wissen. Der Zelltod ist somit ein Sortiervorgang im Körper, während dem die gesunden von den kranken Zellen getrennt werden, zum Schutz des Organismus. Zellen, die einen Fehler aufweisen, das kann eine Krebsform sein oder ein Fehler in der Zellteilung, werden von unserem Körper konstant ersetzt. Für das Kopieren einer Zelle bedarf es der Duplikation von drei Milliarden Basen-Paaren, eine unerhörte Zahl, die den Körper eigentlich vor unlösbare Herausforderungen stellt. Man weiss zudem, dass in unserem Körper pro Sekunde etwa eine Million Zellen absterben und ersetzt werden müssen. Jede Sekunde bildet unser Körper also eine Million Zellen. Auch das ist eigentlich eine unlösbare Aufgabe, die die Natur aber hervorragend meistert. Die Natur ist aber nicht fehlerfrei. Bei jeder Zellteilung kommt es zu ungefähr einem Fehler. Bezogen auf die 3 Milliarden Basenpaare ist das eine fast vernachlässigbar kleine Zahl, eigentlich nichts. Bei einer Million frischer Zellen ergibt das aber immerhin eine Million Fehler pro Sekunde, die sich in unseren Zellen ereignen. Diese Fehler, die eine Zelle akkumuliert, wenn sie nicht gestoppt wird, müssen behoben werden, indem fehlerhafte Zellen eliminiert werden. Eine Akkumulation von Fehlern wird früher oder später in Krebs resultieren, der, wie wir wissen, zum Tode eines Lebewesens führen kann.
Man hatte früher die Meinung vertreten, dass Krebs nur dann entsteht, wenn das Wachstum der Zellteilung beschleunigt wird. Heute weiss man, dass Krebs auch daher kommt, dass eine Zelle mit einem Defekt nicht abstirbt, weil der Zelltodmechanismus nicht richtig funktioniert. Es gibt Bereiche im Körper in denen Zellen dauernd beschädigt werden, so bspw. im Blut, aber auch in der Haut oder im Darm. Hier werden besonders viele Zellen ausgesondert und ersetzt. Über den Zelltod wird erst seit rund 40 Jahren geforscht. Lange Zeit waren viele Zusammenhänge im Körper gar nicht klar. Schon vor Jahrhunderten wusste man, dass bspw. die weibliche Brust grösser wird, wenn sie Milch produziert. Wird das Baby nicht mehr gestillt, bildet sich das Brustgewebe sehr schnell zurück. Man fragte sich, was denn mit den Zellen im Körper passiert. Heute weiss man, dass diese Zellen aufgrund von hormonellen Umstellungen im weiblichen Körper absterben. Diese hormonelle Umstellung erzeugt den Trigger, diese Zellen auszusondern. Wäre dem nicht so, würden sich diese Zellen weiterhin im Körper aufhalten, sie würden möglicherweise mutieren und zu Krankheiten führen. Dank dem Mechanismus des Zelltodes wird der Körper geschützt und gesund gehalten. Der Zelltod ist also nichts anderes als ein Säuberungsprozess des Körpers, der den Tod verhindert.
An Vorträgen spreche ich oft auch über die Kaulquappe oder die Hände eines Embryos. Die Kaulquappe verliert bei ihrer Metamorphose zum Frosch ihren Schwanz. Dieser fällt nicht einfach ab, sondern wird mit Hilfe des Zelltodmechanismus abgebaut. Auch die Bildung der Finger, die anfänglich beim Embryo wie eine Tatze aussehen, ist Resultat des Zelltodes. Die Zellen zwischen den Fingern sterben ab. Das zeigt auch schön auf, dass Erneuerung nur dort eintreten kann, wo gestorben wird, ein grundlegendes Prinzip der Natur.

Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Borner
Xecutives.net: Was unterscheidet den Zelltod vom Tod eines Organismus? Warum kommt es, nebst der Tatsache, dass nur dort Neues entstehen kann, wo auch gestorben wird, überhaut zum Tod und was beschleunigt oder bremst ihn?
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Borner: Vom Zelltod muss die Seneszenz unterschieden werden, die Zellalterung. Gewisse Zellen können sich nur über eine gewisse Zeit teilen. Sie sind immer noch da, können sich aber nicht mehr erneuern. Wenn es sich dabei um Stammzellen handelt, kann das für den Organismus tödlich sein. Das hängt mit unseren Chromosomen zusammen, die mit dem Altern immer kürzer werden. Irgendeinmal sind sie so kurz, dass Sie sich nicht mehr duplizieren können. Seneszenz findet überall statt.
Der Prozess des Alterns findet seinen Grund im plötzlichen „Nichtmehrfunktionieren“ von Zellen, oder in einem Defizit von Zellen. Das heisst, wir sterben eigentlich nicht, weil uns zuviele Körperzellen absterben, sondern weil diese nicht mehr richtig funktionieren, sich nicht mehr teilen oder sich wegen Genveränderungen/Mutationen zu viel teilen, zu einem Krebs ausarten und den Körper geradezu auffressen. Natürlich gibt es auch Prozesse, wo das verstärkte Absterben von Zellen, z.B. von Nerven- oder Immunzellen, zu einer degenerativen Schwächekrankheit, wie z.B. Alzheimer oder AIDS, führen kann und wir dann daran sterben.
Xecutives.net: Schon heute ist es mit Medikamenten und Therapien möglich, das Leben wesentlich zu verlängern. Wird es in naher Zukunft möglich sein, sich Therapien zu unterwerfen, die das Altern und Absterben von Zellen im Körper hinauszögern und zu einem noch längeren Leben führen?
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Borner: Obwohl unser Organismus sehr effizient ist und nur wenige Fehler verursacht, gibt es Hunderte von Proteinen, die eine spezifische Aufgabe haben, den Zelltodmechanismus ermöglichen und Einfluss auf ihn nehmen, falls etwas schief läuft. Funktioniert dieser Mechanismus plötzlich nicht mehr, weil ein Protein fehlt oder defekt ist, kommt es aufgrund von Akkumulationen von Mutationen zu Krebs oder zu anderen Krankheiten und der Mensch stirbt. Die meisten Menschen bekommen Krebs im Alter. Wenn es möglich wird, das Leben zu verlängern, was wir heute, wie Sie richtig feststellen, in einem gewissen Grade schon können, wird die Therapie darin bestehen, die Funktionstüchtigkeit des Zelltodes zu verbessern.
Vielleicht können wir irgendeinmal 120, vielleicht auch 140, Jahre alt werden. Es wird aber sicher nie gelingen, den Tod weiter hinauszuschieben. Eine Möglichkeit, das Leben zu verlängern, besteht darin, nebst dem Erhalt des Zelltodes, dieses Reparatursystem im Körper zu verbessern und seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Es können Proteine, die hierzu von Bedeutung sind, mit speziellen Methoden gepflegt werden. Es besteht die Möglichkeit, fehlende oder wichtige Proteine künstlich zuzuführen. Eine weitere Möglichkeit könnte in Zukunft darin bestehen, die Chromosomen in den Zellen zu verlängern. Was man aber auch immer tut, man läuft das Risiko, dass es zu Krebs kommt, der den Organismus schädigt und zum Tod führt.
Xecutives.net: Menschen, die sich lebensverlängernden Eingriffen unterziehen würden, würden somit mit einer sehr grossen Wahrscheinlichkeit an Krebs erkranken.
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Borner: Ja, das wäre der Preis der lebensverlängernden Massnahme. Man hat mit transgenen Mäusen Versuche gemacht und man hat es geschafft, deren Leben wesentlich zu verlängern. Sie sterben alle an Krebs. Ich gehe jedoch davon aus, dass lebensverlängernde Massnahmen in 20 bis 30 Jahren Teil unserer Gesellschaft sein werden, somit im medizinischen Angebot enthalten sein werden, genauso, wie der Ersatz von Organen. Es werden sich dann unerhörte gesellschaftspolitische Fragen stellen. Es geht darum, wer sich diese Eingriffe leisten kann und wer nicht. Es geht aber auch um die Frage der Überalterung der Gesellschaft, die uns ja schon heute, ohne diese Angebote, vor Herausforderungen stellt.
Xecutives.net: Lebensverlängernde Massnahmen scheinen aber bei Ihrer Forschung nur ein „Nebenprodukt“ zu sein. In Tat und Wahrheit geht es doch um andere Zielsetzungen, etwa um die Behandlung von Parkinson oder Alzheimer.
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Borner: Ja, wir Forscher versuchen, die Mechanismen des Zelltodes besser zu verstehen, damit eines Tages bspw. verhindert werden kann, dass Nervenzellen bei der Parkinson- und Alzheimerkrankheit zerstört werden. Beide Krankheiten zeichnen sich dadurch aus, dass aus irgendwelchen Gründen zu viele Nervenzellen absterben und nicht mehr ersetzt werden können. Das Zusammenspiel der vielen Proteine im Körper ist nach wie vor nicht klar. Man kann nicht einfach ein Molekül in den Körper einspritzen. Die Aminosäuren würden sofort vom Körper abgebaut werden. Man muss darum einen sogenannten Compound herstellen, eine chemische Substanz, die die gleiche Wirkung hat, wie dieses Protein, die vom Körper aber nicht abgebaut werden kann. Das ist Aufgabe der Chemiker in der Pharma-Industrie, die auf diese Weise Medikamente entwickeln. Mit den heutigen Techniken kann man mit Röntgenstrukturanalysen relativ schnell die molekulare Struktur eines Proteins bestimmen. Es kann sogar festgestellt werden, welcher Teil eines Moleküls für welche Reaktion wichtig ist. Ein tolles Beispiel ist meines Erachtens das Medikament Gleevec (Imatinib) von Novartis. Ich hatte am Schluss meiner Doktorarbeit in Basel dieses Medikament auch kurz in den Händen. Wir wussten aber damals noch nicht, was für ein Enzym es hemmt. Heute weiss man, dass das Medikament sehr effizient eine gewisse Art von Leukämie bekämpft. Ein Grossteil der Patienten kann mit Gleevec geheilt werden. Es gibt aber Zellen, die aufgrund von Mutationen resistent gegen die Wirksubstanz werden, ähnlich wie bei Bakterien und Antibiotika. Der Pharma-Industrie gelingt es nun seit kurzem, auch im Fall von Gleevec, die Veränderung des resistenten Enzyms strukturell aufzudecken und eine neue, leicht veränderte, Wirksubstanz herzustellen, die nun das resistente Enzym hemmt und dadurch weiteren Leukämiepatienten das Leben retten kann.
Das ist nun etwas Science Fiction, aber in Zukunft werden Krebspatienten einen individuellen Cocktail von Medikamenten erhalten, der genau auf eine Krebsart und auf deren molekulare Veränderungen/Mutationen abgestimmt ist. Dieser persönliche Cocktail wird seine maximale Wirkung entfalten und damit fallen auch viele unerwünschte Nebeneffekte weg, die heute beim Einsatz von breit eingesetzten Krebsmitteln eintreten. Den von der Presse oft herbeigewünschten „Magic Bullet“, d.h. ein Krebsmedikament, welches alle Krebszellen vernichtet, wird es nie geben, weil die molekularen Mechanismen und Veränderungen von Krebszellen für jede Krebsart einzigartig und komplex sind.
Xecutives.net: Wie wird man sich einen Arztbesuch, wenn es um das Leben, die Gesundheit und die Lebenslänge geht, in Zukunft denn vorstellen müssen, sagen wir bspw. in 30 Jahren?
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Borner: Der Arzt wird, wie heute auch, zuerst feststellen, warum Sie ihn aufsuchen. Er wird das Problem finden und es ist denkbar, dass er dazu das gesamte Genom sequenzieren wird. Er wird also Ihren genetischen Fingerabdruck erstellen und diesen interpretieren. Vor 10 Jahren noch, als diese Sequenzierung möglich wurde, dauerte es Monate, bis das Genom sequenziert werden konnte. Es ist davon auszugehen, dass mit der technischen Entwicklung die Sequenzierung innerhalb von kürzester Zeit, ad hoc, möglich wird. Schon heute dauert das lediglich 2 bis 3 Tage und kostet einige Hundert Franken. Der Arzt wird aufgrund dieses Fingerabdruckes Mutationen feststellen. Vielleicht wird er ein lebensverlängerndes Protein einsetzen, das er Ihrem Körper abgeben wird, um gewissen Mutationen entgegenzuwirken. Das Protein muss aber im Körper richtig verteilt werden, vielleicht mit einer Gentherapie. Das Gen wird hierfür in einen Virus eingepackt, der es in alle Zellen einschleust. Das lebensverlängernde Protein findet damit Zugang zu sämtlichen Zellen. Das könnte auch dazu führen, dass Sie kein Alzheimer oder Parkinson bekommen. Vielleicht wird aufgrund der Analyse Ihres Problems auch klar werden, ob Sie Alzheimer, oder eine andere Krankheit, bekommen könnten. Der Arzt wird mit einer ziemlichen Treffsicherheit voraussagen können, mit welchen Krankheiten Sie sich werden auseinandersetzen müssen. Hier fragt es sich aber, ob Sie das überhaupt wissen wollen.
Xecutives.net: Hat die Auseinandersetzung mit diesen Zusammenhängen rund um das Leben und schliesslich auch mit dem Tod bei Ihnen zu einer Bewusstseinsveränderung geführt, zu einer anderen Einstellung zum Leben gemeinhin?
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Borner: Ich denke, dass ich aufgrund der Forschung für mich selber ein besseres Bewusstsein für meinen Körper gefunden habe. Ich lebe zweifelsohne aufgrund vieler medizinischer, biologischer und chemischer Erkenntnisse gesünder und ausgeglichener als früher. Ich vermittle das auch an Vorträgen, wenn ich zu jungen Menschen spreche. Ich mache sie darauf aufmerksam, dass man ohne Rauchen, Trinken und Stress das Krebsrisiko erheblich minimieren kann. Es gibt aber auch erbliche Vorbelastungen, die zu Krankheiten führen, die nichts mit Rauchen, Trinken und Stress zu tun haben, was oft vergessen geht. Die Länge des Lebens ist auch in erheblichem Masse eine Frage der genetischen Konstellation und damit sicher auch eine Glücksfrage. Trotzdem bin ich der Meinung, dass Menschen in Bezug auf ihre Gesundheit sehr vorsichtig sein sollten, gerade dann, wenn bspw. gewisse Krebsarten in der Familie bekannt sind. Die meisten Krebskrankheiten können heute, wenn man sie im Anfangsstadium erkennt, geheilt werden. Jeder kennt seinen Körper am besten und jeder sollte, wenn er spürt, dass etwas nicht stimmt, einen Arzt aufsuchen.
Xecutives.net: Herr Professor Borner, was wünschen Sie der Forschung ganz generell und was wünschen Sie den angehenden Doktoranden, die Sie betreuen dürfen?
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Borner: Ich wünsche der Forschung, dass sie noch viele neue Entdeckungen macht, die der Menschheit letztlich zu gute kommen. Ich wünsche ihr aber auch, dass sie mehr ethische Verantwortung zeigt, als dies heute der Fall ist. So muss die Privatsphäre geschützt bleiben, vor allem, wenn es um persönliche Daten wie die Erbinformation geht. Weiter wünsche ich mir, dass Forscher dem Druck standhalten, unkontrollierte, präliminäre oder gar bewusst gefälschte Daten zu publizieren, nur um in ihrer Karriere weiterzukommen. Leider sind über 50% der publizierten Daten und auch klinischen Studien nicht reproduzierbar, weil zum Teil einfach zu fest „manipuliert“ oder nachlässig gearbeitet wird. Das schadet den Geldgebern, den Steuerzahlern, den Forschern, welche die Forschungsresultate nicht wiederholen können, und letztlich auch den Patienten, denen man mit dubiosen Forschungsresultaten falsche Hoffnungen macht. Es muss deshalb auch möglich sein, negative Daten, oder Daten, die nicht reproduzierbar sind, publizieren zu können.
Den Doktoranden wünsche ich viele kreative, innovative Ideen, ein starkes Durchhaltevermögen, ein paar einzigartige, „crazy“ Projekte, an die noch niemand gedacht hat, viele gute Mentoren, die sie auf dem Karriereweg begleiten, eine exzellente Ausbildung auch in sogenannten Soft Skills, wie Präsentationstechniken, Verfassen von Artikeln, Zeit- und Projektmanagement, und die nötige Flexibilität, sich den gegebenen Forschungsverhältnissen (finanziell oder thematisch) anpassen zu können und immer am Ball zu bleiben. Letztendlich kann man all das auf einen Nenner runterbrechen: „Living your dream to find something important for human mankind“.
Xecutives.net: Sehr geehrter Herr Professor Borner, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen bei Ihren Forschungsprojekten weiterhin alles Gute und viel Erfolg!
(C) 2015 by Christian Dueblin. Alle Rechte vorbehalten. Anderweitige Publikationen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors gestattet.
Weitere Interviews, die Sie interessieren könnten:
- Thomas H. Zurbuchen – Associate Administrator für das Science Mission Directorate bei der NASA
- Prof. Dr. Gottfried Schatz über Forschung und Technologie sowie die Situation der Universitäten in Europa und den USA
- Prof. Dr. Hans Peter Beck über Gravitation, Gravitationswellen und schwarze Löcher
- Prof. Dr. Hans Peter Beck über Teilchenphysik, das Higgs Boson und darüber, was die Welt im Innersten zusammenhält
______________________________
Links
– Institut für Molekulare Medizin und Zellforschung
– Spemann Graduate School of Biology and Medicine (SGBM)
– International Master/PhD Program in Biomedical Sciences