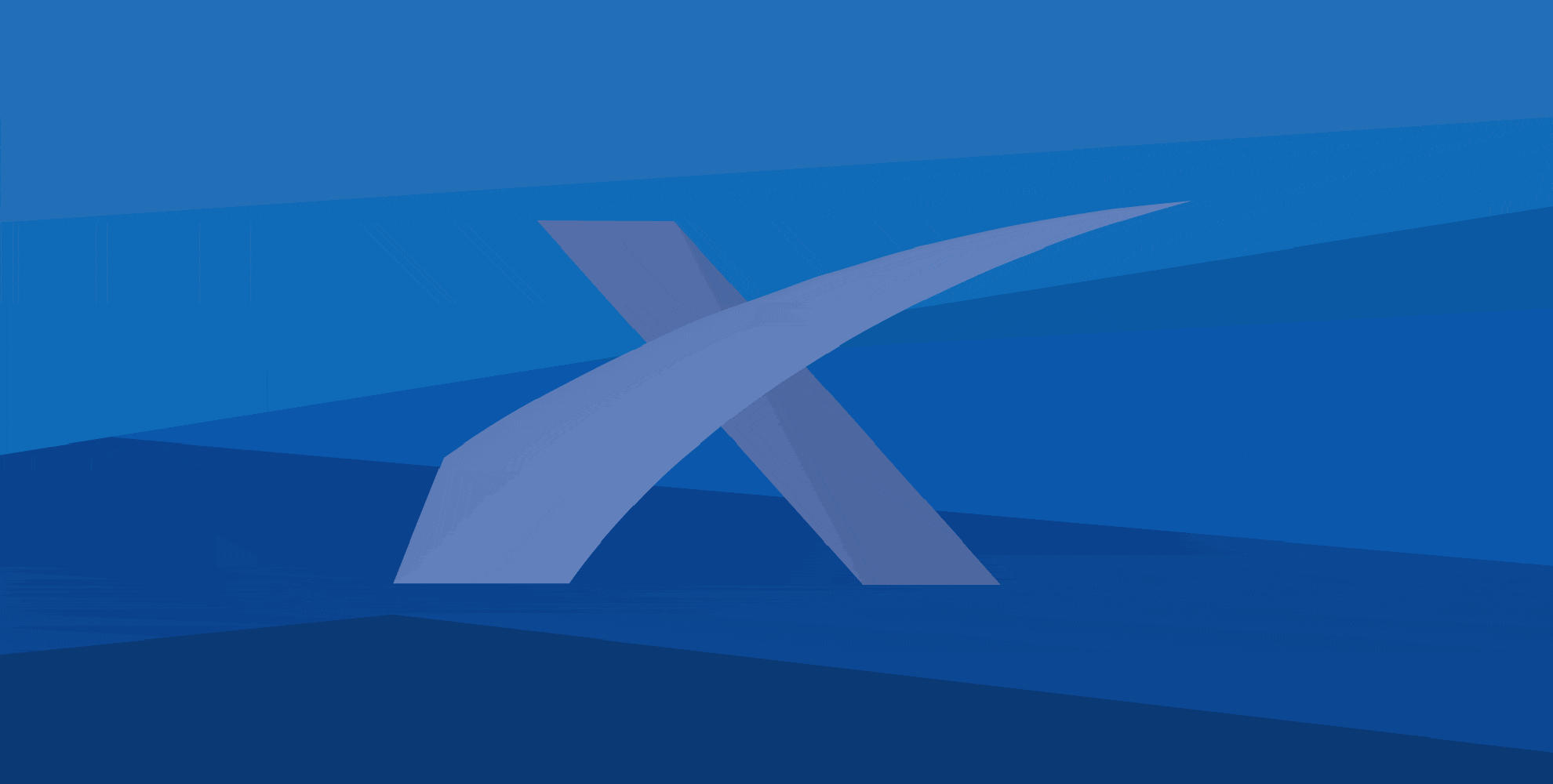Raymond Fein,1950, gelernter Textilfachmann und Jurist, spricht im Interview mit Xecutives.net über seine Passion für den «Boogie-Woogie». Der spezielle Klavierstil hat Raymond Fein jahrzehntelang beschäftigt und noch heute tritt er als Entertainer und Musiker auf und greift in die Pianotasten. Aus seiner frühen Passion für die Musik und aufgrund der Bekanntschaft mit Jean-Marc «Che» Peyer resultierte in den frühen Siebzigerjahren das Duo «Che & Ray», das über 3000 Konzerte gab und diverse musikalische Auszeichnungen erhielt. Raymond Fein ist einem grossen Publikum auch aufgrund seiner Fernsehtätigkeit bspw. für die Sendung «Traumpaar» bekannt (1987-1993), die für Zuschauerrekorde sorgte, die heute unvorstellbar sind.
Im Gespräch mit Xecutives.net beantwortet Raymond Fein Fragen zu seiner Karriere. Er zeigt auf, was den Boogie-Woogie in der Geschichte des Jazz auszeichnet, und beschreibt den Grund dafür, dass sich der Musikstil auch heute noch grosser Beliebtheit erfreut. Raymond Fein spricht über Erfolg und Wahrhaftigkeit in der Musikindustrie und er zeigt Parallelen auf zum Unternehmertum. Seit vielen Jahrzehnten als Kommunikationsberater und Unternehmensberater tätig, unterscheidet er zwischen Kreativität und Innovation, wichtige Themen für die Wirtschaft, die sich auch auf die Musikindustrie übertragen lassen.
Xecutives.net: Lieber Herr Fein, Sie haben sich Ihr ganzes Leben lang mit dem Thema Jazz auseinandergesetzt und ich nehme an, dass der Musikstil Ihr Leben generell sehr geprägt hat. Sie sind selber Jurist und seit vielen Jahrzehnten Unternehmensberater. Bekannt wurden Sie durch die Zusammenarbeit mit Che Peyer mit dem Boogie-Woogie-Duo «Che & Ray», aber später auch mit diversen TV-Formaten, wie bspw. «Traumpaar», mit dem Sie diverse Zuschauerrekorde brachen. Jazz ist eine Musik, die viel Improvisation voraussetzt. Improvisation hat auch mit Unternehmertum und Scheitern und Stolpern zu tun, man macht einen Fehler und muss sehr schnell fähig sein, wieder ins Spiel zu kommen, zu korrigieren, andere Wege zu suchen. Entspricht das auch sonst Ihrer Lebenseinstellung?
Raymond Fein: Ja, absolut! Damit man improvisieren kann, muss man die Songs bzw. das «Thema» sehr gut kennen. Hat man dieses Fundament erarbeitet, das Grundmuster und die Regeln, kann man über jedes Lied bzw. «Problem» hinweg improvisieren. Sie haben das schön gesagt, man scheitert immer wieder auch beim Jazz und tatsächlich ist das ein Aspekt des Jazz, der natürlich bei den Musikern auch Auswirkungen auf das Leben generell hat, auch bei mir. Ich würde aber noch einen Schritt weitergehen. Es geht gerade bei der Improvisation um die Lust, an die Grenzen und darüber hinwegzugehen. Der/die Jazzmusiker/in geht über die Grenzen des Stücks hinaus und entdeckt «Neuland». Mit dem Improvisieren kann man die Freiheit soweit ausleben, dass sogar Neues entsteht. Das ist und war für mich immer sehr reizvoll. Darum ist das «Stolpern», wie Sie sagen, quasi das erste Ziel; es ist aber nur ein Etappenziel. Das Endziel ist, daraus Neues erschaffen zu können. Und hier sehe ich wie Sie den Vergleich zum Unternehmertum natürlich ebenfalls sehr gut. Ich frage in meinen Workshops die Teilnehmenden etwa, was denn der Unterschied zwischen «kreativ» und «innovativ» sei. Ich liebe diese Wortspiele, da sie Anlass geben, sich Gedanken zu machen. Für mich ist – leicht simplifiziert – alles, was neu ist, kreativ, aber wenn es unternehmerisch Sinn und Nutzen macht, dann ist es auch innovativ. Das gilt auch für die Musik. Führt etwas Neues zu einem Mehrwert, dann hat auch die Musik einen Innovationseffekt.

Xecutives.net: Sie zeigen den Teilnehmenden Ihrer Kurse, wie man Innovation in einem Unternehmen ermöglichen kann. Wie gehen Sie vor und was sind Ihre Erkenntnisse? Das ist auch in der Industrie ein sehr aktuelles Thema. Viele Unternehmen können kreativ oder innovativ sein, andere tun sich damit sehr schwer. Und alles hat mit Führung zu tun.
Raymond Fein: Wenn man über Führung spricht, so ist Innovation ein sehr wichtiges, aber auch ein schwieriges Thema. Ich betrachte diese Herausforderung natürlich auch aus der Sicht der Kommunikation heraus. Ich selbst bin seit vielen Jahrzehnten als Kommunikationsberater unterwegs. Meine Arbeit besteht darin, dass ich den Führungskräften und Teams bspw. aufzeige, wie man ein Meeting gestalten kann, so dass es gut abläuft und zielführend ist, resp. möglichst viel Wert dabei entsteht. Ein aggressiver Ton in Meetings zum Beispiel führt oft dazu, dass sich einzelne Teilnehmende nicht mehr zu reden getrauen bzw. keine Lust mehr haben. Das sind Verhaltensmuster, die wir schon seit Hunderttausenden von Jahren mit uns tragen. Aber miteinander gewinnbringend zu kommunizieren, ist die Voraussetzung auch für ein Unternehmen, um erfolgreich zu sein, damit es in der heutigen Zeit bestehen kann. Hier kommt auch die Frage der Teambildung dazu. Es gibt drei Bereiche, die mich und meine Partner beschäftigen. Wir haben diese drei Bereiche mit Farben hinterlegt: Rational (blau), emotional (gelb) und aktional (rot). Man kann auch von drei Ebenen sprechen: Themen-Ebene, Mensch-Ebene und Situations-Ebene, bzw. Denken, Fühlen und Handeln.
Beim Thema „Team“ geht es ums Abwägen zwischen dem Nebeneinander, dem Miteinander und dem Gegeneinander. Viele Führungskräfte sind der Meinung, dass vor allem das «Miteinander» wichtig sei für ein gutes Team. Das ist aber nicht ganz richtig. Es braucht im Team auch das vernünftige «Nebeneinander» und das spielerische «Gegeneinander». Aus «aktionaler» Sicht ist zum Beispiel der Wettbewerb im Team wichtig. Dabei geht es darum herauszufinden bzw. zu entscheiden, welcher «Stürmer» heute der Beste auf dem Platz ist, um ein Team zum Sieg zu führen. Wir erleben das jetzt gerade beim Fussballclub Bayern München, wo Yann Sommer wieder von Manuel Neuer abgelöst werden soll. Die Frage ist, wer in Zukunft der Torwart Nummer 1 sein soll. Yann Sommer hatte rund 20 Spiele Zeit, um zu zeigen, dass er gleich gut oder sogar besser ist als Neuer. Hier geht es um harten Wettbewerb. Yann Sommer, der ein sehr guter Torwart ist, hatte aber mit dem gesamten Team, das darf man sagen, nun etwas Pech. Er hätte noch erfolgreicher sein können / müssen. Der absolut durchschlagende Erfolg – der vielleicht ein Problem für Neuer gewesen wäre – stellte sich bei ihm nicht ein. Im gleichen Team gibt es also die Frage des Ansporns, wer heute und morgen besser ist. Man darf hier von einem positiven «Gegeneinander» im selben Team sprechen. Dieser Aspekt der Teambildung und Teamentwicklung geht in Unternehmen oft vergessen. Diese drei Elemente «aktional», «rational» und «emotional» und deren Relationen helfen zu verstehen, wie Teams effektiv funktionieren sollten.
Innovation, ganz richtig, hat mit Führung zu tun; mit guter Führung schafft ein Unternehmen Werte. Ein Aspekt der Kommunikationsarbeit ist das Definieren, Pflegen und Entwickeln der Werte, die die Firma auszeichnen.
Xecutives.net: Sie haben in den letzten Jahrzehnten viel bewegt und waren mit verschiedensten Projekten sehr erfolgreich. Es ist interessant zu sehen, dass viele Jazzmusiker und Jazzmusikerinnen interessante Lebensläufe haben. Buddha Scheidegger, den wir beide kannten, war nicht nur eine tolle Person und ein ausgezeichneter Jazzpianist, sondern auch Oberrichter und Staatsanwalt. Hazy Osterwald wollte ursprünglich zuerst Fussballer werden, wie sein Vater. Er widmete sich dann aber dem Klavier und später der Trompete. Hazy Osterwald wurde mit seinem Sextett weltweit bekannt und war zu seiner Zeit wohl einer der bekanntesten Musiker überhaupt. Artur Beul, den ich nicht als «Jazzer» betrachten würde, der mit seiner Musik aber auch den Jazz inspirierte, war viele Jahre als Lehrer tätig. Seine Musik ist auf über 50 Millionen Tonträgern verewigt. Andere Jazzmusiker, wie der französische Stride Pianist Louis Mazetier arbeiten als Mediziner. Sie selbst sind Textilkaufmann und Jurist. Wie kam es bei Ihnen, sich plötzlich im Leben für die Musik zu interessieren und diese musikalischen Interessen auch zu einer professionellen Betätigung zu machen? Sie haben viele Preise gewonnen und rund 3000 Konzerte gegeben, nach wie vor treten Sie als Boogie-Woogie-Pianist auf.
Raymond Fein: (lacht) Das ist alles sehr mehrschichtig und nicht leicht zu erklären. Einerseits habe ich am Konservatorium in Zürich bei Kitty Seitz klassisches Piano gelernt. Sie war eine renommierte Persönlichkeit in ihrem Fach, sehr streng, wie man sich eine Klavierlehrerin von damals vorstellen kann. Ich wollte etwas Modernes spielen und sie schlug Rachmaninow vor, was für sie als «modern» galt. Das war natürlich nicht, was ich gemeint hatte. Schliesslich unterstützte sie mich aber doch und gab mir Noten von Winifred Atwell, einer klassischen Pianistin, die dann aber mit Jazz sehr bekannt wurde.

Xecutives.net: Diese Noten gab Ihnen die strenge Lehrerin aber mit zitternden Händen….
Raymond Fein: (lacht) Nein, sie machte das gern, sie erkannte mein Talent und wollte mich unterstützen. Dass Atwell auch eine klassische Pianistin war, erleichterte ihr diesen Schritt aber sicherlich.
Andrerseits hatte ich in frühen Jahren eine Ausbildung als Textilkaufmann gemacht. Ich habe im elterlichen Unternehmen gearbeitet, das war der Fein-Kaller, ein damals sehr erfolgreiches Textilunternehmen. Ich bekam das Unternehmertum als Kind mit der Muttermilch und mit den «Vater-Genen» mit, denn unternehmerische Fragen waren bei uns zuhause allgegenwärtig. Insgesamt arbeitete ich während sieben Jahren als Textilkaufmann in der Firma. Später studierte ich Rechtswissenschaften und arbeitete nebenbei als Lehrer. Nebst Staats- und Rechtskunde und vielem mehr gab ich auch Englischunterricht. Das ergab sich, weil meine Mutter in England aufwuchs und ich zweisprachig erzogen wurde. In dieser Zeit gründete ich zusammen mit Che Peyer «Che & Ray». Ich spielte zuvor in diversen Bands und hatte schon damals viel komponiert. Er sprach mich auf meine Musik an und das war der Beginn unserer Zusammenarbeit. Uns beide verband wirklich eine Art von Seelenverwandtschaft, die in einer langjährigen musikalischen Zusammenarbeit resultierte.
Xecutives.net: Sie beide widmeten sich sehr leidenschaftlich dem Boogie-Woogie, einem speziellen und sehr alten Klavierstil. Insider und wirkliche Fans kennen noch die Namen Clarence «Pinetop» Smith, Meade Lux Lewis, Champion Jack Dupree, um nur einige Ikonen des frühen Boogie-Woogie-Zeitalters zu nennen, eine Musik, die sich noch heute grosser Beliebtheit erfreut.
Raymond Fein: Es war tatsächlich nicht ganz neu, dass zwei Pianisten auch mal zusammen Boogie-Woogie spielten. Die Art und Weise, wie wir auftraten und die Intensität, mit der wir das taten, war aber neu. Fritz Portner spielte damals für Che & Ray eine grosse Rolle. Er war ein guter Freund von mir und war beruflich Marketingspezialist. Er war ein grosser Ideengeber. Mit seiner Hilfe wurde das Projekt zu einem richtiggehenden Hype. Wir machten einen ersten Film, «Burning the Boogie» (1976); da zündeten wir in einer Kiesgrube die Klaviere an, mit vollem Tempo Boogie-Woogie spielend.
Xecutives.net: Ich erinnere mich, diesen Film als kleiner Junge gesehen zu haben und ich war vollkommen begeistert, aber auch etwas verstört, dass man beim Boogie-Woogie spielen die Klaviere anzündete, hatten meine Eltern damals doch grad für mich ein Klavier angemietet…
Raymond Fein: (lacht) Die Botschaft war klar: Die zwei spielen so schnell und intensiv, dass die Klaviere zu brennen beginnen. Das war allerfeinstes Marketing, besser geht es nicht. Damit signalisierten wir auch Freiheit und Keckheit, was die Zuschauer genossen. Der Film schlug ein wie eine Bombe. Der nächste Film musste eine Steigerung sein, was nicht einfach war, aber wir bekamen das wieder auf die Reihe, und zwar mit Paul Grau. Wir nahmen diesmal Flügel und nicht Klaviere und kutschierten – auf diesen Flügeln sitzend, gezogen von Pferden – durch Zürich, übers Bellevue dem Limmatquai entlang. Dann ging es in den Rieterpark und dort explodierten die vier Flügel – natürlich wieder beim schnellen Spielen. Mit diesem Film erreichten wir den ersten Platz an einem Festival für Kurzfilme in Paris. Und mit diesem Preis wiederum schafften wir es damals dann sogar in die Schweizer Kinos als Vorfilm; eine absolute Marketing-Sensation!
Wenn ich diese Geschichte heute einem Marketingexperten erzähle, so kommen dem die Tränen vor Neid bzw. Bewunderung (lacht). Diese Aktionen waren unbezahlbar. Mit diesen erfolgreichen Aktionen legten wir den Boden für den späteren Erfolg von Che & Ray. Wir waren danach fast in ganz Europa auf Tournee.
Xecutives.net: Was war damals die Bedeutung und der Stellenwert des Boogie-Woogie-Stils? Man geht heute davon aus, dass schon um die Jahrhundertwende, also um 1900, Boogie-Woogie gespielt wurde. Seinen Höhepunkt hatte er wohl um 1920 herum, als in jeder Bar und in jedem Theater in den USA Pianisten in die Tasten griffen und das Publikum begeisterten.
Raymond Fein: Boogie-Woogie war zu unserer Zeit eine Form des «Revoluzzertums» – eine Form gegen das Establishment. Die Grenze zum Rock ’n’ Roll ist völlig fliessend. Ohne Boogie-Woogie gäbe es keinen Rock ’n’ Roll. Die Grenze zu Ihrem Musik- und Piano-Stil, zum Stride Piano und damit zum Swing, ist auch fliessend. Ich hatte auch mit diversen Big Bands Konzerte und da einigten wir uns immer auf Stücke, die irgendwo zwischen diesen Stilen pendelten. Das bedeutet, wir konnten die Grenzen sprengen, aber trotzdem eine grosse Anhängerschaft mit Interesse zur Musik ansprechen. Wir spielten auch Ragtime und Blues. Die grosse Stil-Breite von Jazz, also unter anderem vom Blues zum Boogie, vom Swing zu Stride und Ragtime, von A bis Z und zurück, bis hin zum Rock ’n‘ Roll, Hardrock und Freejazz: das alles passte perfekt in die damalige Zeit.

Xecutives.net: Sie sagen hier etwas, was mir auch Erich von Däniken in Bezug auf seine Bücher und Ideen erklärte. Er war in den Gesprächen der Meinung, dass sich sein Erfolg eben dadurch einstellte, dass er im richtigen Moment das richtige Thema bearbeitete. Erich von Däniken hat über 50 Millionen Bücher verkauft. In den USA, mehr noch als in der Schweiz, ist er eine lebende Legende!
Raymond Fein: Ihm ging das wohl genau gleich. In Sachen Musik gab es damals einfach nicht so viele Alternativen für bestimmte Veranstalter oder Anlässe. Es gab die klassische Musik. Es gab «Ländler», einen Musikstil, den ich sehr gerne habe. Man konnte auch Schlager hören. In gewissen Kreisen rümpfte man beim Schlager nach einer gewissen Zeit die Nase. Man war darum für viele Anlässe froh um eine Alternative. Wir spielten oft jede Woche mehrere Male vor ausverkauften Zuschauerreihen, in Konzertsälen genauso wie in Festzelten. Unsere Musik vermittelt gute Laune.
Der Boogie-Woogie ist nicht so aggressiv wie der Rock ’n’ Roll. Wir konnten darum mit dem Stil auch gewisse Menschen aus dem sogenannten «Establishment» ansprechen. Damit waren wir durch die ganze Gesellschaft hinweg «überparteilich». Das entspricht meinem eigenen Wesen. Es gefällt mir nämlich sehr, Dinge zu tun, die viele Menschen ansprechen.
Xecutives.net: Interessant ist, dass sich der Stil Boogie-Woogie nun über 150 Jahre lang halten konnte. Es geht nach wie vor um eine Form von Jazz, die viele Menschen anzieht, gerade auch Kinder, die mithüpfen, wenn man als Pianist in die Tasten greift. Der Boogie-Woogie löst bei Menschen sehr viel aus und geht direkt ins Herz und in den Bauch. Er ist nicht intellektuell, wie andere Jazz-Stile und damit leichter empfänglich für die Menschen.
Was macht Ihres Erachtens den Musikstil auch heute noch so beliebt? Gerade vorhin haben Sie mir einen Boogie-Woogie vorgespielt und es ist schlicht unmöglich, einfach mit verschränkten Armen daneben zu stehen. Der Groove dringt in den Körper hinein und man muss sich nach wenigen Sekunden einfach bewegen…
Raymond Fein: (Lacht) Mir geht das genauso, wenn Sie Stride-Piano spielen. Der Boogie-Woogie hatte auch Zeiten, in denen er populärer war, dann wieder weniger. Er hat sich in den letzten Jahrzehnten beträchtlich entwickelt. Es kommen immer wieder jüngere Musiker, die diesen Stil spannend finden und pflegen. Ich denke hier aktuell in der Schweiz zum Beispiel an Dave Ruosch, den Sie auch kennen, oder an Chris Conz. Das sind ganz hervorragende Künstler auf dem Boogie- und Jazz-Klavier.

Und Sie haben Recht. Auch heute noch erfreut sich der Stil einer grossen Beliebtheit. Stride, wie Sie ihn spielen, hat eher einen etwas intellektuelleren Approach. Das ist auch so beim Modern-Jazz. Dort ist der Zugang noch intellektueller, während der Boogie-Woogie mehr archaische Züge aufweist. Das ist nicht despektierlich gemeint, aber der Boogie-Woogie ist etwas simpler und rudimentärer. Er hat von den Rhythmen her eine gewisse Bodenhaftung. Er hat ein mitreissendes Tempo, das zu begeistern vermag. Die Tempi sind der Beat. Und wenn man «Rolling Stones» hört und den Text versteht, dann wird klar, dass diese Musik auch etwas sehr Archaisches beinhaltet, nicht nur was die Musik anbelangt, sondern auch was die Texte betrifft. Es geht um Liebe und Erotik, oder darum, dass man knapp bei Kasse ist. Es geht darum, von der grossen Liebe verlassen zu werden – oder kein Bier mehr zu haben. Blues und Boogie liegen nahe beieinander, nur ist der Boogie letztlich noch rhythmischer und schneller. Der Blues hat aber dieselbe Archaik und Bodenhaftung. Die Grenze ist beim schnellen Blues und langsamen Boogie sehr fliessend. Es ist nicht Kopfmusik, sondern Bauch- und Fussmusik. Die Musik geht nicht in erster Linie in den Kopf, wo sie zuerst verarbeitet werden müsste, sondern direkt ins Herz und in den Bauch, also in den Körper. Das erklärt auch, warum gerade Kinder sehr gerne zur Musik mithüpfen oder sich bewegen.
Xecutives.net: Vor einiger Zeit musste ich für ein Team von Anwälten und Anwältinnen aus der ganzen Welt in Interlaken einen Team-Event organisieren. Ich engagierte einen Spezialisten auf dem «Schwyzerörgeli» mit zwei in Trachten gekleideten Sängerinnen. Nach lediglich 30 Sekunden hatten die Zuhörer und Zuhörerinnen Tränen in den Augen. Eine Dame aus Brasilien sagte zu mir: «What is happening to me? I must cry.» Das, obwohl die Zuhörerin die Texte über Kühe und Heimweh nicht verstehen konnte. Vladimir Ashkenazy, ein grosser Liebhaber von guter Volksmusik mit grossen Sympathien für den Jazz, hat diesen Effekt im Interview beschrieben, auch Jon Lord von Deep Purple. Es ist wahrhaftige Musik, die «straight» ins Herz trifft. Das scheint auch beim Boogie-Woogie zu passieren.
Raymond Fein: Beim Boogie-Woogie ist das auch so und genau darum spricht er alle Arten von Menschen, alle Geschlechter und Altersgruppen an. Wenn ich in einer Schule oder auch in einem Kindergarten spiele, dann springen die Kids umher, sie tanzen mit. Auch im Altersheim ist das so. Dort klopfen die alten Menschen mit den Stöcken auf den Boden (lacht). Das ist an diesem Musikstil faszinierend.

Die Musik, von der Sie gesprochen haben und die auch Ihre Anwälte und Anwältinnen bewegt, heisst ja «Volksmusik». Das ist nicht die Musik für die Aristokratie oder nur für eine bestimmte elitäre Gruppe. Es ist einfach die Musik für das Volk. Das «Handörgeli» bzw. Schwyzerörgeli (das ich übrigens auch mal begonnen habe zu lernen) ist prädestiniert dafür, diese Musik zu vermitteln, da es vom Klang her auch diese spezielle Melancholie vermittelt, die eben dazu führen kann, dass Menschen zu Weinen beginnen, wie von Ihnen geschildert. Musik vermag Gefühle auf verschiedenen Ebenen anzusprechen bzw. auszulösen. Es gibt auch brillant gemachten intellektuellen Jazz. Dieser hat aber vielleicht nicht den ersten Anspruch, in archaische Gefühle einzudringen, sondern zum Beispiel das Hirn zu kitzeln. Das finde ich genial. Für mich ist Stride-Piano, den Stil, den Sie spielen, ein interessanter Mittelgang. Einerseits gibt es diese linke Hand, die springt und mit viel Fingerfertigkeit verbunden ist, und andererseits die fröhliche Form mit Melodien und Verzierungen mit der rechten Hand, was genau die Lebenslust der Zwanziger- und Dreissigerjahre verkörpert. Stride ist ein Musikstil, von dem sich auch Intellektuelle angezogen fühlen, weil er eine gewisse Komplexität aufweist.
Xecutives.net: Der Stride-Pianist Joe Turner brachte das mit einem Satz auf den Punkt: «It’s music, that makes happy!»
Raymond Fein: Genauso ist es! Und beim etwas simpleren Boogie könnte man sagen: «It’s music, that moves!»
Xecutives.net: Der Boogie-Woogie hat dieses wahnsinnige rhythmische Element in sich. Es geht nicht nur um die vielen Verzierungen, sondern auch um die Rhythmik, was für mich etwas Archaisches hat. Ich gehe davon aus, dass Rhythmus immer etwas war, was die Menschen begeistert hat.
Raymond Fein: Das ist eine verrückte und manchmal auch eine traurige Angelegenheit. Diese guten Seiten der Musik und des Rhythmus haben ja auch eine Kehrseite der Medaille. Wenn man bspw. eine Militärparade sieht, bei der viele Soldaten zu einer Marschmusik schreiten. Da kann man gut (auch an sich selbst!) beobachten, wie dieses «zur Marschmusik marschieren» einen Teil des Denkprozesses abschaltet. Man marschiert in einem vorgegebenen Rhythmus, bei dem man nicht mehr denken muss und auch nicht mehr denken kann, im schlimmsten Fall bis in den Tod. Auch hier wird der Rhythmus eingesetzt, um Menschen zu einem gewissen Tun zu verleiten, in eine Art Trance zu versetzen; dabei wird das Denken aus- bzw. gleichgeschaltet. Wenn man sich ans Handgelenk fasst oder ans Herz, dann spürt man seinen eigenen Rhythmus. Ob dieser schneller oder langsamer ist, hat einen Einfluss auf den Menschen. Wenn man sich verliebt oder beim Boogie ist er schneller (schmunzelt).
Xecutives.net: Diesen Boogie-Woogie-Stil und seine Entwicklung kann man analysieren. Es gibt Gründe, warum der Boogie-Woogie so und nicht anders gespielt wird. Ich denke an die vielen Rent Parties, mit denen sich Musiker und Musikerinnen in der Zeit der Prohibition in den USA die Miete finanzieren konnten. Man lud Gäste in die Wohnung ein, organisierte einen guten Pianisten und begeisterte die Zuhörer, mit dem positiven Effekt, am nächsten Morgen etwas Geld in der Kasse zu haben, ein bekanntes Business Modell aus dem Jazz der Zwanziger- und Dreissigerjahre. Wie hat sich der Boogie-Woogie Ihres Erachtens in Bezug auf das Geschäft entwickelt? War es so, dass die Pianisten merkten, dass sie mehr Geld verdienen konnten, wenn sie unabhängig von einer Band spielten, anstatt mit ihrem Spiel die vielen anderen Musiker einfach selber zu ergänzen?
Raymond Fein: Die Verbreitung von Boogie-Woogie und auch des Stride-Pianos ist interessant. Es ging nicht in erster Linie nur darum, dass die Musiker selber mehr Geld verdienen wollten. In vielen Lokalitäten gab es über viele Jahre Bands, die spielten. Sie kosteten Geld. Wenn nun ein Manager einer Lokalität nur eine Person einstellen musste, welche die Menschen unterhielt, dann kostete das wesentlich weniger Geld, das heisst, es musste eben nicht eine ganze Band bezahlt werden, sondern bspw. nur ein Pianist. Hier geht es wie im Unternehmertum um Wertschöpfung, um Effizienz, um Standardisierung, um Investment und Ertrag. Nur ein Pianist, der die Menschen unterhält, ist um ein Mehrfaches günstiger als eine ganze Band mit vielen Musikern.
Wenn ein Boogie-Woogie-Pianist spielte, war er nicht auf einen Bassisten angewiesen, denn mit der linken Hand wurde dieser ersetzt. Beim Stride Piano ist das auch so. Wenn Sie mit Ihrer linken Hand über Oktaven springen, ist ein Bass nicht mehr gefragt. Es braucht auch keine Klarinette mehr, weil der Boogie-Pianist die verschiedenen Verzierungen, Figuren und Melodien mit der rechten Hand spielt. Ein guter Pianist kann (fast) einen ganzen Bläsersatz ersetzen. Und wenn der Pianist noch mit dem Fuss das Tempo auf den Boden stampft, dann ist auch der Schlagzeuger nicht mehr nötig.
Xecutives.net: Heute würde man wohl von «Konsolidierung» sprechen. Der Markt hatte sich konsolidiert und den effizientesten Weg gesucht.
Raymond Fein: Es handelte sich tatsächlich um eine marktwirtschaftliche Notwendigkeit, Geld einsparen zu können in diesen Rezessionsphasen, was sich auch auf den Stil der Musik auswirkte, bis heute. Mit einem Mann oder einer Frau am Piano konnte genau so viel Bier und Whisky verkauft werden. Darum haben diese Pianisten einen Stil entwickelt, mit dem sie ganze Orchester „ersetzen“ konnten. Für die Musiker-Gewerkschaften war der Boogie-Pianist verheerend.
Es gilt hier noch qualitativ zu unterscheiden: In vielen Spelunken konnte ein Pianist auch überleben, wenn er fünf Mal dasselbe Stück spielte. In gehobenen Etablissements und renommierten Häusern herrschte aber ein sehr grosser Wettbewerb. Die Menschen waren dort sehr anspruchsvoll. Auch Hazy Osterwald wusste das. Mit seiner sehr guten Musik und mit viel Showelementen verstand er es, wie damals kein anderer in der Schweiz, die Menschen zu begeistern. Wenn man dann als Solist auf die Bühne ging, musste man wirklich etwas draufhaben. Wir sehen das auch im klassischen Bereich. Ein Konzertpianist, der in der Tonhalle spielt, hat hinter sich ein Orchester abgelöst, wenn er solo spielt. Um das zu tun, muss der Pianist sehr gut sein. Hier herrscht ein grosser Konkurrenzkampf, wie das auch bei vielen anderen Musikstilen der Fall ist.
Xecutives.net: Es gab ja schon damals diese unglaublichen Überflieger in Sachen Musik und Klavier. Ich denke an Thomas «Fats» Waller, James P. Johnson und Willie «the Lion» Smith, die in Sachen Stride unschlagbar waren. Was hat sie ausgezeichnet?
Raymond Fein: Es bedarf bei allen Karrieren auch eines grossen Glücksfaktors. Ich habe diese Erfahrung selber gemacht. Man wird nicht nur bekannt, weil man gut ist. Man muss im richtigen Moment am richtigen Ort stehen, so wie Ihnen das auch Erich von Däniken erklärt hat. Es bedarf aber auch eines Talentes. Man muss zuerst mal die richtige Person sein, mit einem gewissen besonderen Talent. Dieses Talent braucht es, um erfolgreich zu sein. Alleine aber nützt das Talent nicht viel. Man muss auch den richtigen Zeitpunkt, die richtige Strategie und die richtige Umgebung erwischen. Wenn man die richtige Musik zum „falschen“ Zeitpunkt spielt, dann hat man einfach Pech.
Thomas «Fats» Waller war sicher hervorragend. Aber zu dieser Zeit gab es Dutzende von Pianisten in Hunderten von Spelunken, die gleich gut spielten. Hier geht es wieder um das Thema Kreativität und Innovation, über das wir vorhin gesprochen haben. Ich habe Ihnen von Che & Ray erzählt. Wir beide hatten damals das Glück, meinen guten Freund Fritz Portner mit ins Boot zu holen. Als ausgewiesener Marketingexperte hat er viel zum Erfolg von Che & Ray beigetragen. Ich bin sicher, dass auch ein Thomas «Fats» Waller das Glück hatte, mit den richtigen Personen verbunden gewesen zu sein. Vielleicht hatte er eine Freundin, die wiederum jemanden kannte, der oder die ihm eine erste Möglichkeit gab, sich bei einer grösseren Zuhörerschaft bekannt zu machen, sei das bei einer Plattenfirma oder beim Radio damals.
Man kann also als Musiker, aber auch als Unternehmen, vieles richtig machen. Vieles hängt aber auch davon ab, wie die äusseren Umstände sind. Menschen, die einen Erfolg nur auf sich selber beziehen, erzählen oft nicht die ganze Wahrheit. Der Glücksfaktor und das Umfeld spielen auch in der Musik eine grosse Rolle. Yann Sommer, um ihn noch einmal zu bemühen, hatte bei Bayern München nicht das Glück des Jahrhunderts. In der Zeit, seit er bei Bayern ist, hat er ein Team erwischt, das genau in diesem Moment nicht ganz so erfolgreich war wie auch schon. Hätte er mit Bayern München auch die UEFA-Champions-League und den DFB-Pokal gewonnen und nicht „nur“ die Deutsche Meisterschaft: Wer weiss, wie das „Duell“ mit Neuer dann ausgesehen hätte…
Xecutives.net: Hazy Osterwald erzählte mir viel über seine Karriere, über Erfolge und Misserfolge. 1954 erhielt er in Schweden von einem Freund aus der Schweiz eine Schallplatte von Bill Haley und er wusste, dass sich das ganze Musik-Business, gerade auch der Jazz, verändern würden. Boogie-Woogie und Rock ’n’ Roll stehen sich nahe. Wie verhält es sich Ihres Erachtens um die beiden Musikstile? Hat der Rock ’n’ Roll den Jazz verdrängt?
Raymond Fein: Das ist sehr interessant! Ich würde nicht sagen, dass der Rock ’n’ Roll den Jazz verdrängt hat. Er hat ihn aber erweitert. Auch die Musik verändert sich, wie wir wissen, wie auch die Gesellschaft. Musik hat deshalb immer eine gewisse Signalwirkung, bzw. sie ist ein Gradmesser für eine Gesellschaft. Es geht unter anderem auch um die Frage, wie konservativ oder wie aufgeschlossen Menschen sind.
Es kommt aber noch etwas dazu, nämlich die Texte. Wir Pianisten müssen verstehen, dass nur die Tastatur nicht die ganze Welt ist. Sie ist viel, aber eben nicht alles. Man kann sehr viele Musikstile mit dem Piano erfassen, aber natürlich nicht alles. Mit den Texten gibt es wieder eine Möglichkeit der Kombination, die sehr wichtig ist. Bevorzugt man Heavy Metal, Beat, Hard-Rock, Rock oder Rock ’n’ Roll? Das hat auch mit den Texten zu tun, die eben immer auch eine Geschichte erzählen und damit Menschen auf einer weiteren Ebene ansprechen.
Heute herrscht auf dem Markt eine unglaubliche musikalische Vielfalt, die mich staunen lässt. Ich frage mich, wie die Menschen sich hier zurechtfinden und wie sie sich für „ihre Lieblingsmusik“ entscheiden. Heute sind die Opernhäuser und die klassischen Konzertsäle genauso voll wie die Rock-Stadien, die Blues-Schuppen und die Discos usw. Es gibt Tausende von Streaming-Möglichkeiten auf dem Markt, die alle genutzt werden. Mit Kopfhörer oder Ohrstecker herumzulaufen ist bereits bei vielen Routine. Wie kann man hier noch den Überblick behalten?

Dabei ist das für Musiker/innen heute sehr wichtig. Wenn man früher viele CDs verkaufte, konnte man davon leben. Ich bin insgesamt an 8 goldenen und 3 Platin-Auszeichnungen beteiligt, das heisst, an rund einer halben Million CDs irgendwie „involviert“, die verkauft wurden. Aber der Markt hat sich vollkommen verändert. CDs sind heute höchstens noch eine nette «Liebhaberschaft». Wenn jemand bei mir eine CD kauft nach einem Konzert, wird er sagen, dass seine Grossmutter zuhause noch einen CD-Player hat (lacht). Bei Schallplatten, die wieder ein bisschen gefragt sind, sind es echte Liebhaber, die diese kaufen. Aber: Wenn jemand heute regelmässig zwei Millionen Clicks bzw. Views hat im Internet, dann kommt eben auf diesem Weg ordentlich was zusammen. Die Verbreitung von Musik via Internet ist gigantisch. So hat jede Zeit ihre eigenen Mechanismen.
Jazz war immer anständig. Dann kam der unanständige Rock ’n’ Roll, der viele junge Menschen ansprach, so wie es Hazy 1954 vermutet hatte. Natürlich gab es auch viele laszive Jazz-Nummern. Die Deftigkeit aber brachte der Rock ’n‘ Roll. Von den entsprechenden Texten fühlten sich viele Menschen angezogen. Diese Vielfalt und Möglichkeiten hat der Rock ‘n’ Roll zu nutzen gewusst.
Xecutives.net: Ist das nicht eine riesige Herausforderung für den Jazz, ein Musikstil, der eher im kleinen Rahmen live gehört wird und nicht in den grossen Arenen?
Raymond Fein: Das ist ein heikler Satz von Ihnen. Es gab und gibt durchaus viele Jazz-Musiker/innen, die in riesigen Hallen vor Tausenden von Menschen auftreten. Ich selber war mit Che & Ray als Vorprogramm von «The Manhattan Transfer» unterwegs. Wir hatten damals in Düsseldorf gegen 8000 Menschen vor uns. Diese Menschen mit Boogie-Woogie zu bewegen, war nicht einfach, aber möglich. Wenn man von den hinteren Rängen auf die Bühne schaute, dann war der Flügel 2cm gross und der Musiker bescheidene 1cm. Mit Mimik und Gestik lässt sich dort nicht mehr viel ausrichten. Jazz kann grosse Hallen füllen. Aber jede Zeit hat ihre Art von Musik, Technologie und Verbreitung. Das ist etwas, das ich bedauere. Ich würde gerne länger leben, um zu sehen, was überleben und sich durchsetzen wird. Gibt es das Alphorn noch in 200 Jahren?
Xecutives.net: Johann Sebastian Bach ging wohl 200 Jahre lang in der klassischen Musik vergessen. Erst viel später, lange nach seinem Ableben, sind seine Kompositionen wieder entdeckt und gespielt worden. Vielleicht gibt es ja auch heute Musik, von der wir selber gar nichts wissen, die aber in einigen Jahrzehnten ein «Revival» erlebt.
Raymond Fein: Absolut! Es ist durchaus möglich, dass in den nächsten Jahrzehnten Musik gespielt wird, die heute schon besteht, aber die niemand zur Kenntnis nimmt. Auch ist es sicher so, dass bekannte Musik von heute in einigen Jahrzehnten gar nicht mehr gespielt wird. Das dürfte das Schicksal der meisten neuen Musik sein.
Ich erinnere mich daran, dass mein Vater sich einen Jaguar geleistet hatte. Er fragte mich beim Fahren, ob ich denn wüsste, wie man das Radio im Auto bedienen würde. In diesem Moment dachte ich, wie alt mein Vater doch geworden war, dass er nicht mal wusste, wie man ein Radio bediente. Für mich war es ein simples Radiogerät. Heute erklärt mir mein Sohn, wie ich mein Handy benutzen kann bzw. sollte… Diese technischen Möglichkeiten spielen heute auch in die Musik rein. Es gibt unglaubliche elektronische Möglichkeiten, die sehr spannend sind.
Xecutives.net: Wir sind uns einig, dass es für den Erfolg in Sachen Musik nicht nur Talent bedarf, sondern auch andere Dinge eine Rolle spielen. Wie Sie gesagt haben, man muss im richtigen Moment am richtigen Ort stehen und vielleicht bedarf es auch eines Kontaktes zu einer Produktionsfirma. Es besteht aber die Gefahr, dass die Musik dadurch an Wahrhaftigkeit verliert. Jon Lord hat dieses Thema sehr interessiert. Er meinte, dass es damals mit „Deep Purple“ noch möglich war, sich über Produzenten hinwegzusetzen und das zu tun, was man als richtig und gut empfand. Wie steht es mit dieser Wahrhaftigkeit in der Musik, bei der ich immer davon ausgegangen bin, dass sie im Jazz etwas mehr vertreten ist als bei andern Musikstilen? Ich denke im Moment an Miley Cyrus, die in meinem Umfeld bewundert und gehört wird. Sie ist eine durchschnittliche Sängerin aber die Patentochter von Dolly Parton und tut in Zusammenarbeit mit ihrem Management das, was sich am besten verkauft. Müssen die Zuhörer das wissen, gerade auch jüngere Menschen, die Musik konsumieren?
Raymond Fein: Mir als Unternehmensberater gefällt dieses Wort «Wahrhaftigkeit» sehr gut. Ich kenne auch «echt» oder «eigenständig». Andere Menschen sagen dazu «ehrlich». Mit «ehrlich» habe ich etwas Mühe. Man kann nicht immer ehrlich sein. Es handelt sich um ein Ideal. Es gibt Dinge, wo man eine andere Person schützen muss, weil man ihr nicht wehtun möchte. „Ehrlich“ ist ein Ideal mit einem hohen Stellenwert. Man kann dieses Ideal aber nicht immer 24 Stunden leben. Jemanden aber auf der Wahrheit behaften zu können, auch was sein künstlerisches Schaffen betrifft, das gefällt mir. Das ist schon ein juristischer Begriff (lacht). Die Frage ist nur, was als echt empfunden wird. Auch das ist Thema meiner Workshops. Wenn man bei einem Kunden ist und man ist Verkäufer und man will dem Kunden etwas verkaufen, wie ist man dann glaubwürdig? Das ist eine sehr spannende Frage! Hier geht es natürlich auch um den Gesamteindruck, um die innere und äussere „Haltung“, um die Werte usw. Es gibt viele Werte, die man diskutieren kann und muss.
Im Showbiz stellt sich aber tatsächlich die Frage, ob man wirklich echt oder wahrhaftig sein muss. Das ist eigentlich eine der schönsten Fragen, die mir in einem Interview je gestellt wurde.
Muss man wahrhaftig sein, wenn man im Musikbusiness tätig ist, auch als Pianist? Wenn wir einen Film schauen oder ins Theater gehen, dann ist ja alles, was wir zu sehen und hören bekommen, nicht wahrhaftig. Es ist alles Fake bzw. Kunst bzw. künstlich… Uns kommen im Kino trotzdem die Tränen und wir klatschen im Theater. Muss eine Miley Cyrus echt sein? Oder reicht es, wenn sie künstlerisch gut und professionell ist? Ich kann diese Frage auch nicht abschliessend beantworten.
Es gibt Menschen, die mit ihrer künstlerischen Leistung und mit Wahrhaftigkeit Erfolg hatten. Nach über 50 Jahren Erfahrung im Showbiz bin der Meinung, dass hinter Kunst oft auch (gutes) Marketing steckt. Schauen Sie, ich kann sagen: «Die Kunst- und Unterhaltungsbranche.» Ich kann aber auch sagen: «Die Kunst, und die Unterhaltungsbranche.» Es geht um ein kleines Strichlein! Warum gibt es Bands, die auf ihre Schallplattenfirma und auf die Produzenten hören? Weil Produzenten eben oft nicht blöd sind und wissen, was sinnvoll ist, um auch auf dem Markt Erfolg zu haben. Es geht um den Unique Selling Point bzw. Proposition (USP). Wer von der Kunst leben möchte, muss Geld verdienen. Es geht um die Frage, ob zuerst das Ei da war oder das Huhn: Muss man zuerst Mainstream machen, um dann wahrhaftig sein zu können, oder muss man wahrhaftig sein, um später ein grosses Publikum zu haben? Ich glaube, dass es beides gibt. Es gibt alle Varianten. Dass man eine gewisse Eigenständigkeit hat, ist sicher gut und sinnvoll. Wenn man aber ein Nischenprodukt herstellt, dann muss man auch nicht den allerersten Anspruch haben, ein Millionenpublikum zu erreichen. Man ist dann in der Nische der King, damit lässt sich aber möglicherweise kein Vermögen verdienen. Erfolg ist sowohl im Unternehmertum als auch in der Kunst sehr vielschichtig. Gier ist in beiden Fällen abträglich.
Xecutives.net: Sie hatten und haben sehr viel Erfolg. Während das Projekt Che & Ray sehr erfolgreich war, waren Sie auch für das Fernsehen tätig bspw. mit der Sendung «Traumpaar». Wie Kurt Felix, der sich im Interview zum Thema Erfolg und Quoten äusserte, hatten Sie mit dieser Sendung damals ein Millionenpublikum vor sich. Ich erinnere mich selber an das «Schnüfeli» und an die Kulisse dieser Sendung. Wie kam es zu diesem Projekt?
Raymond Fein: Die Sendung «Traumpaar» war ein grosser Erfolg. Sie haben die Kulisse angesprochen und hier geht es um die «Bildhaftigkeit». Wir haben damals die Idee für diese Kulisse so entwickelt, wie sie uns zum Motto passend erschien: Traumpaare im Paradies! Die Sendung lief sieben Jahre und ich hätte sie wohl noch lange weiter «betreiben» können. Als ich aufhörte, hatten wir rund 22’000 Anmeldungen von Menschen, die gerne hätten mitspielen wollen. Die Zuschauerquote betrug damals 54%. Das kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Die Sendung «Kassensturz» und die «Tagesschau» hatten ähnliche Quoten, auch Beni Thurnheer mit «Tell-Star». Aber es gab schon damals sehr viel Konkurrenz. Ich denke, man darf die Sendung als «Strassenfeger» bezeichnen. Wenn man Einschaltquoten als eines der Pflicht-Ziele einer „Publikums-Unterhaltungssendung“ betrachtet, dann haben wir damals sicher alle Erwartungen übertroffen. Ich hatte immer grosse Lust darauf, etwas in dieser Richtung zu tun. Mit Che & Ray war meine Moderation ein Teil des Erfolgs. Es war damals nicht unbedingt üblich, dass Musiker das Publikum auch mit Sprüchen und Anekdoten unterhielten. Im klassischen Bereich sagte man «Guten Abend» und dann am Schluss «Danke». Bei Che & Ray war aber das Entertainment ein fester Bestandteil, es gehörte deshalb dazu, sich verbal ans Publikum zu wenden.
Xecutives.net: Haben Sie damit auch von der Ausbildung zum Juristen profitiert? Immerhin sind Juristen oft fähig, sich grammatikalisch und eloquent mit der Sprache auseinandersetzen zu können?
Raymond Fein: Ja und nein! Sicher ist, dass Jurist/innen die Sprache beherrschen müssen. Es gehört zum Beruf dazu, sich präzis ausdrücken zu können. Ich habe aber schon viel früher angefangen, das Publikum mit der Sprache zu unterhalten. Das gehörte für mich eben zum «Entertainment» dazu. Und vielleicht war das damals schon ein Anzeichen dafür, dass ich später den Weg zum Fernsehen einschlug. Durch Che & Ray war ich bereits in Kontakt mit dem Fernsehen. Marco Stöcklin, damals Leiter der Abteilung „Unterhaltung“, fragte mich irgendwann, ob ich vielleicht etwas Fernseharbeit lernen möchte. Philip Fluri präsentierte zu dieser Zeit eine Art Quiz. Er benötigte dafür einen Redaktor. Ich wurde dann dieser Redaktor, der alle die Fragen entwerfen und die Sendung redaktionell betreuen durfte. Ich machte das rund eineinhalb Jahre und fing daneben an, das Format «Traumpaar» zu entwickeln.
Und hier sind wir wieder beim Thema: Es war der richtige Moment. Ich kannte die richtigen Leute. Es war der richtige Ort. Das Thema war auch richtig. Das waren nun die optimalen Voraussetzungen, ein tolles Format zu lancieren. Ich habe das alles mit viel Leidenschaft gemacht.
Heute sage ich an Coachings und Seminaren immer wieder, dass sich Leidenschaft nicht pensionieren lässt (lacht). Ich habe nicht Boogie-Woogie gespielt, weil das viele Menschen hören wollten. Ich glaube, das zeichnet viele Jazzmusiker aus. Ich habe Boogie-Woogie gespielt, weil ich das sowieso und extrem gern spielte. Beim Fernsehen ging es mir dann ganz ähnlich. Ich wollte Menschen auf eine gute Art und Weise unterhalten, parteiüberschreitend.
Xecutives.net: Herr Fein, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute bei Ihren Projekten!
© 2023 by Christian Dueblin. Alle Rechte vorbehalten. Anderweitige Publikationen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors gestattet.
Diese Interviews könnten Sie auch interessieren:
- Hazy Osterwald über seine Karriere als Bandleader, seine Liebe zum Jazz und die Musik vor und nach dem zweiten Weltkrieg
- Artur Beul über sein Leben, seine Musik und seine Welthits
- Dick Hyman about playing the piano, jazz and life
- Jon Lord about composing, his music career and the developments in the music industry
- Chris Hopkins über Jazz und Echoes of Swing, seine musikalische Karriere und über Hazy Osterwald, Ralph Sutton und Dick Hyman
- Dave Ruosch über seinen musikalischen Werdegang und die Blues- und Jazzszene in der Schweiz
- Kurt Felix über seine Karriere, das Medium Fernsehen und die Grenzen des Geschmacks
- Richard Clayderman about “Ballade pour Adeline”, his approach to music and his personal feelings about interpretations
- Rita Juon Turner über ihren Vater – Harlem Stride Pianist Joe Turner (1907 – 1990)
Raymond Fein auf Wikipedia