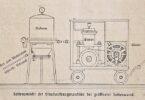Andrea Raschèr studierte an der Universität Zürich Rechtswissen-schaften und promovierte zum Thema des Urheberrechts der Bühnenregie («Für ein Urheberrecht des Bühnenregisseurs – Eine rechtsvergleichende Studie mit spezieller Berücksichtigung der Theatersemiotik und der Folgen für die Bühnenpraxis»). Seine Dissertation wurde mit dem Professor Walther Hug Preis ausgezeichnet. Von 1995 bis 2006 war Andrea Raschèr Leiter Recht und Internationales im Bundesamt für Kultur (BAK), wo er mit der damaligen Bundesrätin Ruth Dreifuss zusammenarbeitete. Er inszenierte während und nach seiner Studienzeit als Regisseur Opern, eine Arbeit, die ihn in die besten Opernhäuser Europas führte. Ausserdem hat er an der Hochschule für Angewandte Psychologie mit einem MAS in Coaching und Supervision abgeschlossen. Raschèr hat sich insbesondere in der Auseinander-setzung mit Raubkunst und Provenienzforschung einen Namen gemacht. Zu diesem Thema publiziert er regelmässig, wie beispielsweise im Standardwerk «Kultur Kunst Recht», Basel 2020. Andrea Raschèr war Delegationsmitglied an der «Washington Conference on Holocaust Era Assets» und hat am Kompromissvorschlag für die Washingtoner Raubkunst-Richtlinien von 1998 mitgearbeitet.
Im Interview mit Xecutives.net beantwortet Andrea Raschèr Fragen zu seinem Leben, zu Kunst, zu Sammlern von Kunst und zeigt auf, wie man mit einem narrativen Lösungsansatz Provenienz-forschung betreiben kann. Er beschreibt, welchen Stellenwert Provenienzforschung früher und heute hat. Die Richtlinien der Washingtoner Konferenz haben den Umgang gerade mit NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern von Grund auf verändert. Wer sich vor Jahren noch mit solchen Kulturgütern quasi schmücken konnte, ohne sich lästige Fragen anhören zu müssen, muss heute über die Herkunft der Werke Bescheid wissen. Raschèr zeigt auch auf, wohin die Reise vieler Museen gehen könnte, die sich heute mit Restitutionsanliegen aus anderen Ländern auseinandersetzen müssen.
Xecutives.net: Herr Raschèr, Sie haben unlängst für Tele Südostschweiz ein interessantes Interview gegeben. Der Titel des Interviews lautete «Andrea Raschèr – Von «Rigoletto» bis Raubkunst». Der Interviewer hat Sie über Ihr Leben befragt. Sie sind promovierter Jurist mit einem sehr untypischen Lebenslauf für Juristen. Man kennt Sie, um jetzt nur mal einige herausragende Momente in Ihrem Leben zu beschreiben, aufgrund der Washingtoner Richtlinien, auf die wir noch zu sprechen kommen und den damit verbundenen Tätigkeiten in Sachen Raubkunst. Wer sich für Oper interessiert, kennt Sie auch aufgrund Ihrer Tätigkeit als Opernregisseur, andere kennen Sie als Persönlichkeitscoach und Mediator oder auch als Journalist. Selber Jurist würde ich mal sagen, dass das eine sehr erfrischende juristische Laufbahn ist.
Andrea Raschèr: Bereits während meiner Gymnasialzeit waren Musik und Theater meine Leidenschaften. Diese Themen haben mich nebst Physik, Philosophie, Geschichte und Sprachen fasziniert. Ich wusste damals nicht, was ich beruflich machen wollte. Mich reizte so ziemlich alles, von Elektroingenieur bis Bühnenregisseur. Kurz vor der Matura absolvierte ich im Institut für Angewandte Psychologie (IAP) einen Abklärungstest. Das Resultat zeigte, dass ich die Qual der Wahl hatte, was ich studieren wollte. Die Beraterin empfahl mir, Jura zu studieren, weil es das «Schweizer Taschenmesser» unter den Studienrichtungen sei und weil ich während des Studiums getrost meine Arbeit als Regisseur machen könne. Und man finde immer einen Job, weil Juristinnen polyvalent eingesetzt werden können. Während meines Studiums habe ich dann tatsächlich zur einen Hälfte der Zeit an Opernhäusern gearbeitet als Regieassistent und Regisseur und zur anderen habe ich studiert.
Xecutives.net: Sie haben Interesse für Geschichte, für Kunst, für Philosophie, für Elektronik und auch für Psychologie. Sie sind musikalisch interessiert und kennen die Opernbühnen. Insofern ist die Tatsache, dass Sie sich auch mit Raubkunst und Provenienzforschung auseinandersetzen wollen und können, irgendwie logisch. Es bedarf eines guten Kunstverständnisses, historische Kenntnisse, Kreativität, Verhandlungsgeschick und Sie kennen das Handwerk des Juristen.
Andrea Raschèr: Für mich war wichtig zu lernen, wo ich im Leben Akzente setzen will. Ich bin ein neugieriger Mensch und wollte bereits als Kind, den Dingen auf den Grund gehen. Diese Neugier und die Menschenliebe waren für mich immer der Hauptantrieb. Ich arbeite gerne mit und für Menschen. Ich frage mich immer wieder, was Menschen veranlasst etwas zu tun. Da kommt die Psychologie ins Spiel. Das ist auch ein Grund dafür, dass ich auch Mediation betreibe und auf dem Gebiet der Persönlichkeitsentwicklung beratend tätig bin. Das mache ich alles als privater Unternehmer. Aber wenn es um Raubkunst geht, wird man schnell zur öffentlichen Figur und polarisiert möglicherweise. Hier muss man lernen, wie man mit der Öffentlichkeit umgeht.
Neugier allein aber reicht nicht aus. Es braucht auch einen Sinn. In der Kunst besteht der Sinn darin, etwas erschaffen oder mit erschaffen zu können, etwas zu entwickeln. Wenn es um das Thema Raubkunst geht, spielt die Aufarbeitung von Geschichte eine zentrale Rolle. Nicht allein als Selbstzweck, sondern auch als Bewusstsein dafür, dass Deutung von historischen Ereignissen stets aus der Gegenwart erfolgt. Es geht auch um Gerechtigkeit und wie wir damit umgehen im Einzelfall.

Xecutives.net: Gerade wenn es um Raubkunst oder Provenienzforschung geht, geht es um Geschichten, hinter denen Menschen stecken. Es geht um Konflikte, um die öffentliche Wahrnehmung, um Gerechtigkeit, aber auch um Verletzlichkeit. Schliesslich betrifft es auch sehr schwierige Rechtsfragen. Interessant finde ich in diesem Zusammengang den Weg zu Ihrer Dissertation. Auch in Bezug auf Ihre Dissertation gibt es eine gewisse Logik. Sie haben sich dabei mit Urheberrechten von Regisseuren und ihren Inszenierungen beschäftigt.
Andrea Raschèr: Im zweiten Semester meines Jurastudiums sprach ich mit Professor Manfred Rehbinder über meine Dissertationsidee. Er fand das etwas frech, weil ich noch nicht einmal die Zwischenprüfung abgelegt, geschweige denn bestanden hatte. Er meinte, dass er aus rechtlicher Sicht diametral anderer Meinung war. Ich solle nach der Zwischenprüfung wieder kommen. Trotzdem begann ich, Literatur zu meinem Dissertationsthema zu sammeln. Meine Mappe war stets voll mit Artikeln und Büchern. Das Schreiben meiner Dissertation grad im Anschluss an das Studium dauerte darum nur wenige Monate, weil ich alle Arbeitsunterlagen bereits zusammengestellt hatte. Überall, wo ich als Opernregisseur arbeitete, fand man mich in den Bibliotheken, wo ich auch rechtsvergleichenden Studien nachging. Tagsüber und abends war ich an den Proben und frühmorgens traf ich mich mit Professoren und Professorinnen und studierte in den Bibliotheken. Professor Rehbinder war dann später doch angetan von meiner Dissertationsidee und er hat mich sehr unterstützt.
Oft spielten viele Zufälle eine Rolle. Ich hatte das Glück, für Jean-Pierre Ponnelle und Nikolaus Harnoncourt zu arbeiten und mit vielen anderem Menschen, die mich sehr inspiriert haben. Später im Bundesamt für Kultur mit David Streiff und mit der besten Chefin der Welt, Bundesrätin Ruth Dreyfuss. Alle diese Menschen haben mich gefördert und mir Chancen gegeben.
Xecutives.net: Wie kamen Sie zum Bundesamt für Kultur?
Andrea Raschèr: Wie die Jungfrau zum Kind! Ich bin von einem Kollegen angesprochen worden, der vom Bundesamt für Kultur zum Bundesamt für Justiz wechseln wollte, zu Heinrich Koller, den Sie ja bestens kennen. Ich erkundigte mich, was die dort so machen. Ich durfte mich am Folgetag beim Direktor David Streiff vorstellen und bald hatte ich die Stelle. Auch das war ein sehr glückliches Ereignis. Ich befasste mich im Bundesamt für Kultur mit vielen Projekten, an denen das Bundesamt für Justiz beteiligt war, so bspw. auch Heinrich Koller. Mit ihm war ich im Stiftungsrat des Institutes für Rechtsvergleichung in Lausanne. Er war Präsident der Stiftung und ich habe gerne mit ihm zusammengearbeitet und schätze ihn menschlich sehr.
Xecutives.net: Wir werden über Kunst, über Raubkunst und Provenienzforschung sprechen, sehr schwierige Themen, die auch politisch brisant sind, wie die Auseinandersetzungen rund um die Sammlung Bührle in Zürich zeigt. Zuvor möchte ich Sie jedoch fragen, was für Sie persönlich Kunst bedeutet.
Andrea Raschèr: Kunst bedeutet für mich Transzendenz und die Faszination für die menschliche Kreativität.
Xecutives.net: Wir sprechen von teilweise sehr teurer Kunst. Gemälde werden oft mit zweistelligen Millionenbeträgen gehandelt, womit wohl keiner der alten Maler und Malerinnen gerechnet hätte. Mir scheint, dass Transzendenz oft weniger eine Rolle spielt im Kunsthandel. Manch ein alter Künstler oder eine alte Künstlerin hätte sich wohl nicht erträumen können, dass ihre Kunst auch im Rahmen der Washingtoner Konferenz über Vermögenswerte aus der Zeit des Holocaust 1998 eine Rolle spielen würde.
Andrea Raschèr: Wenn diese Künstlerinnen und Künstler sehen könnten, wie teuer gewisse Gemälde heute gehandelt werden und was für ganze Wissenschaftszweige sich wegen ihrer Kunst entwickelt haben, dann wären diese Menschen wohl überrascht. Sie hätten möglicherweise Mühe, das System um ihre Kunst herum zu verstehen und vielleicht auch, es zu akzeptieren.
Xecutives.net: Wir reden von Kunst und auch grossen Sammlungen, die seit Jahrzehnten teilweise in den Medien erscheinen und in der Öffentlichkeit auch politisch diskutiert werden. Dazu gehören die Sammler Bührle, Flick, Reinhart, aber auch der 2014 verstorbene Cornelius Gurlitt, der in den Medien vorgeführt wurde. Diese Menschen hatten offenbar ein Interesse an Kunst, sicher auch Freude an Kunst. Für Kunst gibt es gigantische Märkte und nicht alles ist sauber. Das hat auch mit Provenienzforschung zu tun, wenn geforscht wird, unter welchen Umständen Kunst- und Kulturgegenstände die Hand gewechselt haben. Wann beginnt in unserer Geschichte diese Provenienzforschung, die 1998 an der Washingtoner Konferenz eine ganze wesentliche Rolle spielte?

Andrea Raschèr: Wir müssen einen Schritt zurück gehen, wenn wir diese Frage beantworten wollen. Kunstwerke, die von den Kunstschaffenden signiert wurden, wie wir sie heute kennen, gibt es grundsätzlich seit der Renaissance. Zuvor wurde vor allem für Gott und Kaiser geschaffen. Mit der Renaissance und beispielsweise den Medici, kam bei Menschen der Wunsch auf, sich mit Kunst zu adeln – da spielten die Namen der Kunstschaffenden eine wichtige Rolle, quasi als Status-Symbol. Die Medici kamen aus dem Söldnerwesen und wurden schnell reich, später mit ihrem Bankhaus. Sie fingen an, Kunst zu sammeln. Man schmückte sich mit Künstlerinnen und Künstlern und ihren Werken und konnte sich damit auf diese Weise unsterblich machen, was in gewisser Weise ebenfalls mit Transzendenz zu tun hat. Es ist bemerkenswert, dass die ersten Gesetze, welche die Abwanderung von Kulturgut regelten, in der Renaissance im Kirchenstaat und in Florenz erlassen wurden. So durften beispielsweise Werke von Leonardo da Vinci aufgrund dieser Gesetze nicht ausgeführt und in andere Regionen gebracht werden.
Xecutives.net: Es ging auch um Identifikation. Man war der Meinung, dass Leonardo nach Florenz gehörte und der Abfluss seiner Kunst schädlich für die Stadt wäre…
Andra Raschèr: Absolut! Der Materialwert einer Mona Lisa beträgt wenige Franken – Leinwand, Holz, Farben. Das aber, was die Kunst ausdrückt und bedeutet, das Transzendente, macht sie zu wichtigen Kunstwerken. Dabei geht es auch um die emotionale Bindung, nicht zuletzt zwischen dem Sammler und der Kunst. Das spielt im Umgang mit Raubkunst eine grosse Rolle, weil diese emotionale Bindung zwischen einer Eigentümerin oder einem Eigentümer und einem Kunstwerk unterbrochen wird.
Provenienzforschung ist, so wie sie heute betrieben wird, jüngeren Datums. Noch bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist es mehr darum gegangen, ob man eine Fälschung vor sich hatte oder nicht. Das war für Museen, Händler und Sammler entscheidend. Darum betrieb man Provenienzforschung in Bezug auf die Qualität eines Originals bei einem Kunstwerk. Erst als die Nationalsozialisten anfingen, Kunst zu rauben, fing man an, Provenienzforschung in grösserem Stil als Aufarbeiten der Besitzergeschichte und Handwechsel von Kunst zu verstehen.
Provenienz war aber ebenfalls in zwei anderen Gebieten wichtig: Zum einen bei der archäologischen Forschung und bei der Erforschung von Kulturgütern in einem ethnologischen Kontext. Mit archäologischen Funden ging man noch im 18. und 19. Jahrhundert sehr objektorientiert um. Man sprach von einem schönen Kopf aus Stein, von einer schönen Statue. Erst im 20. Jahrhundert kamen dann auch Fragen auf, woher diese Kultur- und Kunstgüter überhaupt stammen und welches der Fundkontext ist. Die Provenienzforschung, die heute vor allem wegen des unglaublich riesigen Kunstraubs des Nazi-Regimes betrieben wird – das sieht man sehr schön an den Studienprogrammen, die angeboten werden -, sind alle jüngeren Datums. Den Master «Provenienzforschung interdisziplinär» an der Universität Bern, in welchem ich Kunst- und Kulturgüterrecht lehre, gibt es erst seit einigen Jahren in dieser Form. Das grosse Interesse der Studentenschaft zeigt die Wichtigkeit und die Notwendigkeit für ein solches universitäres Angebot.
Xecutives.net: Es gibt das Identitätsstiftende, wie möglicherweise Florenz und Leonardo, was auch verständlich ist, war er doch eine interessante und für die Stadt bereichernde Figur. Es gab aber schon sehr früh Menschen, die ganze Sammlungen zusammengekauft haben. Ich denke beispielsweise an Katharina die Grosse, die regelmässig ganze Sammlungen erwarb und dafür ihre Händler einsetzte. Dahinter steckt ja nicht nur die Kunst an sich, die man gerne hat, sondern auch eine gewisse Habgier und die Zurschaustellung von Macht. Dieser Touch von Macht, Gier und Geld steckt doch irgendwo auch hinter dem Kunstmarkt und macht ihn anfällig für Unrecht?!
Andrea Raschèr: Das ist sehr vielschichtig. Was mir bei vielen Sammlern und Sammlerinnen auffällt, ist ihre Neugier und Lust und Freude an Kunst. Der oder die Sammelnde freut sich, ein Kunstwerk geniessen zu dürfen. Der von Ihnen angesprochene Aspekt von Haben oder Sein spielt im Kunstmarkt auch eine Rolle. Allein die Sammlerin oder der Sammler bestimmt, wer ein Kulturgut wann und wo sehen darf. Das hat sehr viel mit Machtausübung zu tun, unter welchen Umständen jemand einen Kunstgegenstand sehen darf – oder eben nicht. Erich Fromm lässt grüssen.
Ein Sammler, dem ich versprochen habe, nie seinen Namen in diesem Zusammenhang zu nennen, meinte in einem Gespräch, dass er und seine Mitsammler etwas zwischen einem Junkie und einer sexbesessenen Person darstellen. Er wollte damit sagen, dass er und seine Kollegen und Kolleginnen von etwas getrieben sind. Das bedeutet, dass eine Sammlung für diese Sammler und Süchtigen nie fertig ist, es braucht immer noch einen Schuss mehr. Er meinte, dass er von seiner Sucht erst befreit wäre, wenn er sich von der Sammlung trennen würde, dann wenn er die Sammlung einem Museum oder einer Stiftung abgeben würde. Das war ein sehr ehrliches Statement, das mich beeindruckt hat.
Was Sie am Beispiel von Katharina der Grossen oder Napoleon I. beschrieben haben, zeigt, dass die Aneignung von Kunst auch mit politischer Macht und mit Unterdrückung zu tun hat. Sie gingen sehr feldzugmässig vor. Göring machte das bei den Nazis. Hitler wollte das mit dem sogenannten Führermuseum in Linz.
Wenn Sie die Sammlungen von Emil Bührle und Oskar Reinhart anschauen, dann erkennen sie, dass diese Menschen sehr gezielt gesammelt hatten. Sie stellen fest, dass es eine Ordnung und Entwicklung in den Ausstellungen gibt, die Sinn machen. Das zeichnet diese Sammlungen aus. Es handelt sich quasi um eine Art sekundäre Kreativität dieser Sammelnden. Die beiden hatten die Fähigkeit, einzigartige Sammlungen zusammenzustellen und zu entwickeln. Das bringt Museen in eine problematische Lage. Heute erhalten die Museen solche Sammlungen, als Schenkungen oder Leihgaben, jedoch mit der Auflage, dass die Gemälde genau so aufgehängt werden müssen, wie das der Sammler oder die Sammlerin haben wollte. Oskar Reinhart hatte testamentarisch festgelegt, wie seine Kunst ausgestellt werden muss.
Xecutives.net: Angela Rosengart war im Gespräch überhaupt nicht erfreut, dass man sich über diesen testamentarischen Willen hinwegsetzt. Sie meinte, dass es den Willen des Sammlers und Stifters zu achten gelte.
Andrea Raschèr: Das sind sehr schwierige und komplexe Sachverhalte. Es fragt sich, ob diese Kunstwerke künftig zusammen mit anderen Gemälden gezeigt werden können. Die Behandlung einer Sammlung als Monolith im Haus ist eine Herausforderung auch in anderen Museen. Es fragt sich, ob man diesen monolithischen Block ändern kann und trotzdem wertschätzend mit einer Sammlung umgeht.
Xecutives.net: 1998, rund 50 Jahre nach dem Nazi-Regime, kam es mit der Washingtoner Konferenz zu Bewegung auf dem Kunstmarkt. Bevor wir genauer auf diese Konferenz und ihre Folgen eingehen, fällt aber doch schon auf, dass es gerade auch die Sammler und Händler waren, die kein allzu grosses Interesse daran hatten, den Kunstkäufen und allfälligem Unrecht beim Erwerb von Kunst, nachzugehen.
Andrea Raschèr: Das gleiche Problem stellt sich bei den Kulturgütern und Raubgrabungen. Was im Boden unbefugt geborgen wird, ist einem Diebstahl gleichgesetzt und somit illegal. Trotzdem wurden diese Kulturgüter geraubt und gesammelt, schon vor mehreren hundert Jahren. Auch hier kann ein System des Schweigens und Wegschauens nicht wegdiskutiert werden. Das System geht so: Ich weiss, aber ich frage nicht. Du weisst und Du fragst auch nicht. Demnach sind das klar Missbrauchssysteme. Wenn alle mitmachen und alle schweigen, dann können solche Systeme bestens funktionieren. Bewusst wurde das allen aber erst mit dem unmenschlichen und verabscheuungswürdigen System der Nazis, die während Jahren Menschen umgebracht und ihr Eigentum geraubt haben. Früher konnte man deren Kunst kaufen und sich damit brüsten, ohne dass kritische Fragen gestellt wurden. Wenn das Sammlerinnen und Sammler, also Private machten, dann ist das schlimm genug. Wenn aber Museen involviert sind, die mit Steuergeldern finanziert werden und solche Kulturgüter ausstellen, dann muss das von Grund auf erforscht und die Ergebnisse veröffentlicht werden. So haben beispielsweise die Verantwortlichen um das Kunsthaus Zürich lange Zeit weggeschaut.

Im Übrigen folgt auf das Wegschauen, psychologisch betrachtet, die Scham. Man hat auf der einen Seite etwas, das einen adelt, etwas, das eine Person wichtigmacht. Wenn das aber auf der anderen Seite mit grossem Unrecht zu tun hat, so widersprechen sich das Habenwollen und die Scham. Sie kommt auf, wenn man weiss, dass man etwas tut, das nicht in Ordnung ist.
Xecutives.net: Emil Bührle hat wohl deswegen auch eine Kirche gespendet. Die Welt hat sich nun aber in den letzten Jahren verändert. Die Menschen sind aufmerksamer. Der «Fall Bührle» schafft es heute in die New York Times. Zürich hat nicht damit gerechnet, was für ein Shitstorm mit der Sammlung auf das Kunsthaus zukommt. Nun ist das aber beispielsweise bei der Sammlung Gurlitt anders abgelaufen. Cornelius Gurlitt vermachte seinen Kunstbesitz dem Kunstmuseum Bern. Dort hat man es offenbar geschafft, mit dieser Sammlung, ich würde sagen, vorbildlich umzugehen.
Andrea Raschèr: Cornelius Gurlitt erhielt diese Kunstwerke zum grossen Teil von seinem Vater. Er hat immer wieder Werke in der Schweiz verkauft, meist über die Galerie Kornfeld in Bern. Bei einer Ausreise aus der Schweiz wurde er vom Zoll kontrolliert, was dann zu einer grossen Durchsuchung führte, die medial begleitet wurde. Es kam, wie das so ist, zu grossen Narrativen. Eines bestand darin, dass man Gurlitt fälschlicherweise unterstellte, er verfüge über einen Raubkunstschatz. Er vermachte diese Sammlung später dem Kunstmuseum Bern, wo man sich die Annahme des Erbes in Bern sehr gut überlegt hat. Es ist der klugen Verhandlungsleitung von Marcel Brülhart zu verdanken, dass eine optimale Lösung gefunden wurde. Das Kunstmuseum entschied, die Erbschaft anzunehmen, vorausgesetzt, dass kein Kunstwerk nach Bern kommen darf, das offensichtlich Raubkunst darstellt.
Kunstwerke, deren Herkunft lückenhaft war, hat man zwar übernommen, um dann sorgfältig deren Herkunft und Erwerb abzuklären. Es wurde eine Provenienzforscherin damit beauftragt, die Kunstwerke zu überprüfen. Sie hat das hervorragend erledigt. Ich wurde zur Beratung beigezogen und es ging um die Frage, wie man rechtlich mit Kunstgegenständen umgehen kann, bei denen es Lücken gibt. Der übliche Ansatz bestand darin, weiterzuforschen, wenn Lücken vorhanden waren; es gibt in diesem Zusammenhang die unsägliche Redewendung, etwas sei noch nicht «ausgeforscht». In vielen Fällen ist aber die Chance, dass man noch klärende Unterlagen und Dokumente findet, gering; die Recherche dauert und ist oft von Zufällen abhängig. Man muss bedenken: Die oft lange Diskriminierten, dann Beraubten und Verfolgten standen meist unter enormem Druck und mussten in aller Hektik alles zurücklassen. Vieles ist von den Nazis zerstört worden oder ging im Krieg unter. Das Kunstmuseum hat dann entschieden, Kunstwerke, bei denen man notwendige Dokumente und Informationen bislang nicht beschaffen konnte – oder die möglicherweise nicht zugänglich sind, trotzdem anzunehmen. Darüber hinaus wollte Bern offen mit den Wissenslücken umgehen. Das ist der Paradigmenwechsel, den das Kunstmuseum Bern vollzogen hat.
Xercutives.net: Verstehe ich das richtig, es wird jedes Gemälde abgeklärt und nicht nur die Gemälde, an denen möglicherweise jemand einen Anspruch stellt?
Andrea Raschèr: Ja. Jedes einzelne Kunstwerk wird abgeklärt. Es gibt Situationen, in denen durch die Provenienzforschung beispielsweise eine Familie ausfindig gemacht wird, deren Vorfahren ein Gemälde weggenommen oder geraubt worden ist. Dann nimmt das Museum mit den Nachkommen Kontakt auf. Diesen proaktiven Ansatz verfolgen nicht viele Museen. Das zeichnet das Kunstmuseum Bern aus.
Xecutives.net: Die Washingtoner Konferenz hat 1998 Richtlinien zur Art und Weise von Provenienzforschung und zum Umgang mit Raubkunst abgegeben, aber keine bindenden Regelungen. Wie kam das?
Andrea Raschèr: Die Richtlinien der Washingtoner Konferenz von 1998 sind als Soft Law sogenannte «narrative Normen». Soft Law setzt das gesetzte Recht nicht ausser Kraft und es ist gerichtlich nicht direkt durchsetzbar. Aber das Gericht wird das Soft Law in seiner Abwägung berücksichtigen müssen, vor allem, wenn das Gesetz dem Gericht einen Ermessensspielraum einräumt, wie beispielsweise beim «guten Glauben». Das Soft Law gibt dazu die Orientierung. Je länger es dieses Soft Law gibt, desto mehr werden Institutionen, welche die Washingtoner Richtlinien nicht befolgen, in Erklärungsnot und Begründungszwang geraten. Auch das Kunsthaus Zürich bekennt sich seit kurzem öffentlich zu den Washingtoner Richtlinien, was einen Wandel bedeutet. Zudem bieten diese Richtlinien einen gewissen Spielraum für die Länder und ihre Museen, um neue Lösungswege und Lösungen zu entwickeln
Xecutives.net: Was war damals das Umfeld und der Grund, dass es zu dieser Washingtoner Konferenz kam. Das waren nicht die Museen und Kunstsammler, die sich diese Konferenz gewünscht hatten.
Andrea Raschèr: Das Ganze hängt zusammen mit den Debatten um Nachrichtenlose Konten auf Schweizer Banken. Ende Achtzigerjahre und Anfang Neunzigerjahre wurden sehr viele Archive in Osteuropa zugänglich. Dabei gelangten riesige Bestände von Archivmaterialien an die Öffentlichkeit. Ich war damals im Bundesamt für Kultur und bekam das Dossier über den illegalen Kunsthandel von der damaligen Bundesrätin Ruth Dreyfuss übertragen. Dort ging es vor allem um Archäologie und Diebstahl. Auf einer Fahrt nach Bern las ich im Tagesanzeiger einen zweiseitigen Artikel des Historikers Thomas Buomberger über Oskar Reinhart und Emil Bührle. Mir wurde bewusst, dass nach den Nazigold-Herausforderungen es als nächstes um die Schweiz und um NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter gehen wird. Es war klar, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis dieses Thema international Aufsehen erregen wird.
Xecutives.net: Hat sich die Schweiz vorbereitet auf eine weitere Auseinandersetzung?
Andrea Raschèr: Ich habe im Bundesamt gesagt: Wir müssen vorbereitet sein und dafür müssen wir zwei Studien haben. Eine interne über die Bestände des Bundes und eine externe historische Untersuchung über die Rolle der Schweiz und den Kunsthandel im Zweiten Weltkrieg. Mit letzterer wurde Thomas Buomberger beauftragt. Mit diesen Studien ging es darum, vorbereitet zu sein, für den Fall, dass in der Schweiz oder aus anderen Ländern Vorstösse kamen.
So war es dann: Nur wenige Monate später traf im BAK der Brief vom State Department aus den USA ein, unterzeichnet von Stuart Elliot Eizenstat, mit 40 Fragen zum Umgang der Schweiz mit Kunst und dem Zweiten Weltkrieg. Aufgrund der Aufarbeitung konnte ich rund 35 der 40 Fragen problemlos beantworten. Die anderen 5 Fragen waren heikel. Bern bekam dann Besuch von zwei Experten vom State Department und die beiden erklärten mir: «Either you answer those questions, or someone else will». Kurze Zeit später wurde die Schweiz offiziell zur Washingtoner Konferenz über Vermögenswerte aus der Zeit des Holocaust eingeladen. Es wurde schnell klar, dass die Schweiz im Fokus der Amerikaner stand, so wie das schon beim Nazi-Gold im Jahr 1996 der Fall gewesen war.
Xecutives.net: Wie ging die Schweiz vor?
Andrea Raschèr: Ich hatte die beiden Studien in der Tasche und nahm mit den wichtigsten Kunstmuseen in der Schweiz Kontakt auf. Ihnen empfahl ich, eine Erklärung zu unterzeichnen, die wir ausgearbeitet hatten und den Amerikanern vorlegen wollten. Es bedurfte gelinde gesagt etwas Überzeugungsarbeit, aber ich bekam diese Unterschriften und mit dem ganzen Material flogen wir nach Washington. Wir erhielten vor Ort, wie andere auch, einen Text, der auf das amerikanische Rechtssystem zugeschnitten und mit unserem System nicht kompatibel war.
Vor Ort waren wir als Schweiz im Fokus und es wurde immer wieder die Sammlung Bührle genannt. Die Sammlung war den Amerikanern bestens bekannt und sie diente bereits damals als Projektionsfläche für Raubkunst in der Schweiz. Ich präsentierte den Amerikanern unsere Studien und die Erklärung, die von den Museen in der Schweiz unterzeichnet worden war. Dann fragte ich in die Runde der Staaten, wie das denn die anderen Länder machen, auch mit Blick auf die USA.
Xecutives.net: Damit haben Sie den Fokus von der Schweiz genommen…
Andrea Raschèr: Das hatte tatsächlich zur Folge, dass die USA den Fokus plötzlich auf andere Länder legten, so beispielsweise auf Frankreich und Deutschland. Die Verhandlungen gingen dann weiter. Es ging noch um andere Themen, wobei die Kunst das wichtigste Thema war.
Am letzten Tag sollten die Richtlinien verabschiedet werden. Es zeichnete sich jedoch ab, dass diese von den Amerikanern entwickelten Richtlinien von vielen Ländern nicht akzeptiert worden wären, insbesondere nicht von Deutschland und Frankreich. Die Normen wären auch für die Schweiz nicht akzeptabel gewesen. Ich besprach mich mit Thomas Borer, der die Delegation leitete, und ersuchte ihn, mir eine Audienz bei Stuart Eizenstat zu organisieren. So konnte ich Eizenstat am Folgetag einen Vorschlag unterbreiten, der für die Amerikaner und die anderen Länder akzeptabel war. In der Präambel sollte stehen, dass jedes Land diese Principles im Rahmen der eigenen Rechtsordnung umsetzt. Das Treffen war im Büro von Stuart Eizenstat, der mit einem ganzen Tross von US-amerikanischen Schwergewichten auf der anderen Seite eines grossen Tisches sass. Mich erinnerte das Setting aus performativer Perspektive an das Letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci. Die US-Amerikaner wussten, wenn wir keine Lösung finden, dann scheitert die Konferenz. Zu meiner Linken sass der Vertreter Deutschlands, zu meiner Rechten der Vertreter Frankreichs und beide waren gegen den Text, den die USA vorgelegt hatte. Stuart Eizenstat fragte mich, ob ich eine Lösung hätte und ich zog einen kleinen handgeschriebenen Zettel aus meiner Tasche und fragte Eizenstat, ob ich meinen Vorschlag vorlesen dürfe. Es stellte sich dann heraus, dass neben den USA auch Deutschland und Frankreich meinen Vorschlag für passabel hielten. Stuart Eizenstat fragte mich noch während der Sitzung, ob er den Zettel haben dürfe, auf dem ich nachts meinen Vorschlag notiert hatte.

Xecutives.net: Die Konferenz hat viel ausgelöst. Es wird für viele Museen zunehmend schwieriger, Vorstösse auszusitzen. Man muss auch mit Shitstorms rechnen wie im Fall des Zürcher Kunsthauses. Was hat sich seither verändert in Sachen Provenienzforschung?
Andrea Raschèr: Seit 1988 hat sich viel verändert. Die Schweiz hat ihre Beziehungen zu Nazi-Deutschland ausgiebig aufgearbeitet. Wichtig ist, dass man mit dem heutigen Wissen über die historischen Gegebenheiten anders umgeht als noch vor 20 Jahren.
Xecutives.net: Was sind die Lösungsansätze?
Andrea Raschèr: Es bedeutet ein Umdenken, dass man mit Kunst heute auch anders umgehen kann und es nicht nur Schwarz- oder Weisslösungen gibt. Die Lösungen, die man mit Bezug auf die Washingtoner Richtlinien herbeiführen kann, sind erstaunlich vielfältig. Man kann ein Kulturgut zurückgeben, eine Entschädigung zahlen, und es gibt Fälle, ein restituiertes Werk im Museum zu belassen oder ein restituiertes Werk einem anderen Museum zu überlassen, mit der Auflage, dass man den Weg, den das Kunstwerk gemacht hat, also die Geschichte der Menschen, die betroffen sind, benennt. Der Skandal im Vorfeld der Eröffnung des Neubaus des Zürcher Kunsthauses hat dazu beigetragen, dass man heute in Zürich darüber nachdenkt, mit der Sammlung Bührle anders als geplant umzugehen. Wir dürfen gespannt sein, was mit der die Sammlung noch passieren wird.
Xecutives.net: Ich finde den Kulturgüterstreit zwischen St. Gallen und Zürich in diesem Zusammenhang sehr interessant. Er zeigt, dass wir auch innerschweizerische Herausforderungen bestehen müssen. In diesem erst vor wenigen Jahren geklärten Fall, musste der Bund nach einer Lösung suchen für einen fast 300-jährigen Fall. Was sind Ihre Erinnerungen?
Andrea Raschèr: Es war Ende 1999 oder Anfang 2000 als ich im Bundesamt für Kultur Post aus St. Gallen bekam. St. Gallen stützte sich in einem Antrag auf Art. 44 Abs. 3 der Bundesverfassung und ersuchte den Bund in Sachen Kulturgüterstreit zwischen St.Gallen und Zürich zu vermitteln. Das war das erste Mal, dass dieser Artikel zur Anwendung kam. Der Streit ging zurück auf die Villmerger Kriege von 1712, als Zürich und Bern St. Gallen angriffen und dort den Stiftsbezirk plünderten. Bern hat später alles zurückgegeben. Zürich hat einen Teil der Güter behalten. St. Gallen stellte also das Vermittlungsgesuch an den Bund zur Lösung des Problems. Der Bundesrat hat ein Mediationsteam zusammengestellt, das aus Pascal Strupler als Generalsekretär des Innendepartements, Luzius Mader als Vertreter des Bundesamtes für Justiz und mir als Vertreter des Bundesamtes für Kultur bestand. Es kam zu insgesamt rund 17 halb- bis ganztägigen Sitzungen mit Vertretern aus Zürich und St. Gallen.
Für Zürich war es wichtig, dass der Kanton nicht als Räuber angesehen wird. Den St. Gallern war wichtig zu zeigen, dass es sich um Objekte handelt, die identitätsstiftend sind. So anerkannten die St. Galler, dass Zürich Eigentümer der Güter bleibt und Zürich anerkannte das Identitätsstiftende für St. Gallen und entschied sich, die Kulturgegenstände an St. Gallen auszuleihen. Das Ganze haben wir mit einem Vertrag abgesichert, der sehr komplex ist, was die Kündigung angeht. Das heisst, die Güter sollten in St.Gallen ihren Platz wieder gefunden haben.
Ein bekanntes Objekt in diesem Streit ist der Himmelsglobus, der sich im Besitz des Landesmuseums in Zürich befindet. Hier setzte die narrative Lösungsfindung ein. Zürich entschied sich, eine Replik herzustellen und stellte dafür rund eine Million Franken zur Verfügung. Über 100 Spezialistinnen und Spezialisten aus der ganzen Welt brachten ihr Know-how ein und es resultierte eine absolut geniale Nachbildung des Himmelsglobus. Nur ein Detail: Es gab einen Einhaarpinsler, der ebenfalls an diesem Wunderwerk arbeitete. Er zeichnete mit einem Pinsel mit einem Haar die feinsten Details auf den Globus. Auch die ganze Mechanik wurde nachgebaut. Das Original ging dann zwei Jahre nach St. Gallen, quasi, um davon Abschied zu nehmen. Nach zwei Jahren ging das Original wieder ins Landesmuseum und die Replik steht heute in St. Gallen. Diese Replik ist nun Teil der Stiftsbibliothek geworden und mit dieser gemeinsamen Geschichte wird diese Replik für die St. Galler zu einem «neuen» Original, auf das man stolz sein darf.
Xecutives.net: Dieser Fall kann doch als Vorbild dienen für Museen auf dieser Welt, die sich immer mehr mit solchen Fragen befassen müssen.
Andrea Raschèr: Nein, Vorbilder gibt es nicht. Jeder Fall ist einzigartig. Das ist wichtig. Es gilt zwischen Lösung und Prozess zu unterscheiden. Für die Lösung gibt es keine Vorbilder, denn jeder einzelne Fall ist anders. Jedoch kann man die Erfahrungen aus dem Prozess durchaus betrachten. Wir haben als Mediatorenteam vor allem den Parteien zugehört. Es war uns ein Bedürfnis zu verstehen, welches die Anliegen der Parteien waren und wo die Interessen lagen. Erst dann wird es möglich, aus den Schnittstellen eine gemeinsame Lösung entwickeln zu können. Die St. Galler waren der Ansicht, dass sie das, was zu ihrer Identität gehört, vor Ort haben wollten. Dieses Vorgehen unterscheidet sich von einer postkolonialistischen und paternalistischen Herangehensweise, wo man als Vermittler den Streitparteien einfach etwas auferlegt. Wenn es also um Kulturgüter beispielsweise aus ehemaligen Kolonien geht, muss man mit den betroffenen Menschen zusammensitzen, ihnen aufmerksam zuhören, um zu verstehen, was diese Menschen beschäftigt, was sie bewegt und was ihnen wichtig ist. Der Rest ergibt sich meist von selbst. Es gilt, eine gemeinsame Geschichte für den Gang in die Zukunft zu finden.
Xecutives.net: Ich gehe stark davon aus, dass sich die Museumslandschaft in den nächsten 10 bis 20 Jahren sehr verändern wird, weil sich Museen aktiv mit solchen Situationen auseinandersetzen müssen und viele Sachen nicht einfach ausgesessen werden können. Wie sehen Sie die Museumslandschaft mit ihren Veränderungen in der Zukunft?
Andrea Raschèr: Die Herausforderungen für Museen werden komplexer. Schauen Sie das British Museum an und die Forderungen aus Griechenland zu den Teilen des Parthenon, die Lord Elgin unter zweifelhaften Umständen aus Athen nach London verbracht hatte. Es bedarf hier kreativer Ansätze und die werden für jeden einzelnen Fall anders sein. Das ist eine grosse Chance. Viele Museen haben verstanden, dass es nicht um die Kulturgüter an sich geht, sondern darum, ein Teil derer Geschichte zu sein. Oft ist eine Seite bereit, etwas abzugeben, wenn sie Teil der Geschichte wird.
Die neue Museumsdefinition von Internationalen Museumsrats ICOM weist hier in eine Richtung. So werden sich Museen nicht nur fragen, ob ein Kulturgut bei ihnen richtig aufgehoben ist, sondern, ob es nicht an einem anderen Ort auch gut aufgehoben wäre, eben nur anders. Das heisst aber, dass es gleichzeitig Wertschätzung demjenigen gegenüber bedarf, der für ein Kulturgut in den letzten Jahren gesorgt und es gepflegt und bewahrt hatte.
Xecutives.net: Sehr geehrter Herr Raschèr, ich bedanke mich herzlich für die Einblicke in Ihr Leben, die interessanten Kunstthemen und auch für die Zeit, die Sie sich für das Interview genommen haben. Ich wünsche Ihnen bei Ihren Projekten weiterhin alles Gute und viel Erfolg!
© 2022 by Christian Dueblin. Alle Rechte vorbehalten. Anderweitige Publikationen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors gestattet.
Hier finden Sie die Website von Herrn Andrea Raschèr: www.rascherconsulting.com
Diese Interviews und Berichte zum Thema Kunst könnten Sie auch interessieren:
- Angela Rosengart über ihre Lieblingsmaler Pablo Picasso und Paul Klee sowie über die Geschichte der Galerie Rosengart in Luzern
- Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth über die Würth-Gruppe, den Zusammenhang zwischen Kunst und Unternehmertum sowie Europas Zukunft
- Erwin Wurm über sein künstlerisches Schaffen, seine Skulpturen und was man in seiner Kunst zwischen den Zeilen lesen kann
- Bettina Eichin über ihr Leben, ihr Kunstverständnis und ihre Skulpturen
- Kaspar M. Fleischmann über die Anfänge der Fotografie, die Fotografie als Kunstform und seinen Visionen für die Fotokunst
- Ansicht über Impressionismus im Jahr 1883
- Prof. Dr. iur. et lic. oec. HSG Heinrich Koller über die Vielfalt juristischer Berufsmöglichkeiten