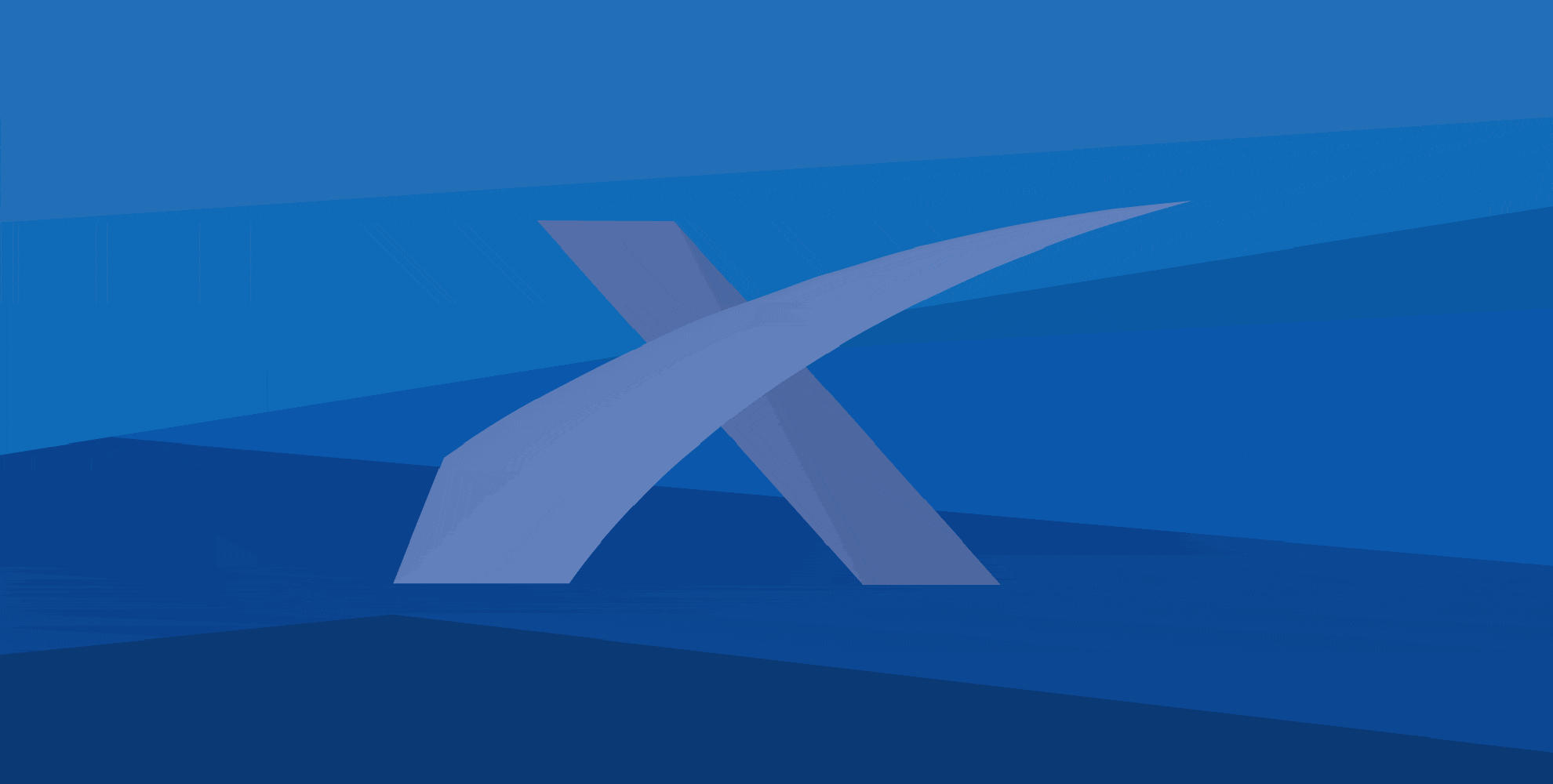Rolf Lyssy
Rolf Lyssy, Jahrgang 1936, hat mit vielen seiner Filmwerke Filmgeschichte geschrieben. Mit seinem Film „Die Schweizermacher“ sicherte er sich einen prominenten Platz in der Ahnengalerie des Schweizer Films und er schenkte damit einem Millionenpublikum weit über die Schweizer Grenze hinaus Freude. Der Film „Die Schweizermacher“ hat nicht an Aktualität verloren. Die Frage der Identität, wer wir sind, wie wir uns definieren, was wir als schweizerisch und nicht schweizerisch erachten, aber auch das Schicksal von Minderheiten und deren Ausgrenzung hat Rolf Lyssy sein Leben lang beschäftigt. „Die Schweizermacher“, aber auch Filme wie „Leo Sonnyboy“ und sein letztes Filmwerk „Die letzte Pointe“ hätten alle Stoff und genügend Substanz auch für ein Drama geboten. Lyssy aber will ernsthafte und sehr komplexe Themen immer wieder mit Humor angehen und den Zuschauer mit Komik und Lachen zum Denken anregen. Im Interview mit Christian Dueblin zeigt Rolf Lyssy Parallelen zwischen „Die Schweizermacher“ und dem Film „Konfrontation“ auf. Darin behandelt er das Leben des Juden und Medizinstudenten David Frankfurter, der 1936 in Davos den Landesgruppenleiter der NSDAP-Auslandsorganisation, den Nazi-Chefstrategen in der Schweiz, Wilhelm Gustloff, mit mehreren Pistolenschüssen niederstreckte. Er zeigt auf, wie sich die Geografie der Schweiz auf unser Denken und Verhalten auswirkt, aber eben auch auf die Filme, welche in der Schweiz gemacht werden. Rolf Lyssy erklärt schliesslich, warum Filmemachen in der Schweiz, im Gegensatz zu anderen Ländern, ohne Subventionen nicht möglich ist.
Xecutives.net: Lieber Herr Lyssy, in der Auseinandersetzung mit Ihnen und Ihrem Filmwerk ist mir aufgefallen, wie viele Schnittstellen es zu Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern gibt, mit denen ich in den letzten Jahren Gespräche führen durfte, auch mit Menschen aus dem Filmgeschäft. Ich werde Ihnen einige Namen aufzählen und Sie dürfen sich einen Namen aussuchen: Georg Kreisler, Hazy Osterwald, Prof. Dr. Gottfried Schatz, Fredi M. Murer, Emil Steinberger, Hans Theodor Sieber, Giacun Caduff, Artur Beul, Hans Liechti, Samir und Sabine Boss. Es gäbe noch viele mehr. Mit wem möchten Sie hier ins Gespräch einsteigen?
Rolf Lyssy: Die Wahl fällt mir nicht leicht, weil ich die meisten der von Ihnen genannten Personen kenne und schätze. Ganz spannend sind für mich Hazy Osterwald und Georg Kreisler. Ich würde mich gerne für Hazy Osterwald entscheiden.
Xecutives.net: Das ist eine hervorragende Wahl. Hazy Osterwald hat eine wahnsinnige Karriere hingelegt. Wie Sie, ist er dem Jazz vollends und sein Leben lang verfallen. Ende der Fünfzigerjahre merkte er mit dem Aufkommen des Rock’n Roll, dass sich auf der Welt musikalisch etwas verändern wird. Er erzählte mir viel von Teddy Stauffer und Fred Böhler, aber eben auch von dieser Zäsur mit dem Jazz. Es war ihm auf Anhieb klar, dass die Musik, wie er sie kannte, mit dem Aufkommen von Elvis nie mehr die gleiche sein wird. Er selber wollte sich dem Rock’n Roll nicht zuwenden und hielt am Jazz fest. Mich erinnert das ein bisschen ans Filmgeschäft in der Schweiz, an die Zeit von Franz Schnyder und Kurt Früh. Diese und andere Regisseure machten vor sechs Jahrzehnten in der Schweiz unglaublich erfolgreiche Filme, wie bspw. „Ueli dr Knecht“, „Ueli dr Pächter“ und „Hinter den Sieben Gleisen“, Kinofilme die regelmässig von einem Millionenkinopublikum gesehen wurden, Filmwerke, die junge Menschen heute in der Regel nicht mehr kennen. Warum waren diese Filme so populär und was führte dazu, dass der Gang ins Kino zum Schweizer Film in den letzten Jahrzehnten abnahm und das Kinopublikum arg geschrumpft ist, mit entsprechenden Auswirkungen aufs Filmgeschäft?
Rolf Lyssy: Damals kam das Fernsehen auf. Ich selber bin noch mit Radio, Büchern und Theater aufgewachsen, natürlich auch mit dem Kino. Wenn man nicht Radio hörte, und man hörte in der Regel nur Radio oder widmete sich Büchern, ging man hin und wieder ins Kino und ins Theater. Das war noch ein Erlebnis. Man kann sich das heute fast nicht mehr vorstellen. Nestlé war damals mit ihrem Fip-Fop-Club unterwegs und das Unternehmen hat in der ganzen Schweiz mit mobilen Projektionsgeräten in den Sälen Filme vorgeführt. Viele Schulklassen gingen diese Filme schauen. Mich hat das sehr geprägt, was auf der grossen Filmleinwand ablief. Ich war aber auch ein leidenschaftlicher Radiohörer. Hörspiele zogen mich extrem an. Später hörte ich American Forces Network (AFN) aus München. Dadurch kam ich auch zum Jazz, der mich bis heute beschäftigt.
Mit dem Radio wurde meine Phantasie angeregt. Und dann kam das Fernsehen auf, das alles verändern sollte, auch die Produktion von Filmen. Während des Krieges wurden diese tollen und aufwändigen Produktionen von legendären Filmemachern wie Schnyder und Früh in der Schweiz gemacht. Der Import von Filmen aus dem Ausland war damals nicht einfach und die Schweiz machte ihre eigenen Filme, mit grossen Budgets, nahezu konkurrenzlos. Als die Grenzen nach dem Krieg wieder aufgingen, kamen immer mehr ausländische Filme in die Schweiz, was nun zu Konkurrenz führte. Der alte Schweizer Film, von dem Sie sprechen, starb Mitte bis Ende der Sechzigerjahre. Ich selber war während dieser grossen Zeit des Schweizer Films 1961 Kameraassistent im Film Demokrat Läppli von Alfred Rasser.
Das Fernsehen hatte gravierende Auswirkungen auf den Film. Die Filmemacher mussten sich anpassen. Man hörte damals, das Kino sei tot. Das war aber nicht wahr. Es kamen neue Filmschaffende und passten sich den neuen Begebenheiten an. Die Zeit der grossen Schweizer Spielfilme mit einem Millionenpublikum und grossen Budgets war damit aber weitgehend vorbei.
Xecutives.net: Sie sind engst mit dem Jazz verbunden und es fällt auf, dass Menschen, die Jazz hören und spielen gewisse charakterliche Eigenschaften aufweisen, die andere Menschen nicht, oder weniger ausgeprägt, haben. Jazz besteht aus Improvisation, aus dem Zusammenspiel mit anderen Musikern. Er bedarf einer gewissen Freiheit, ist rhythmisch, Musiker müssen beim Improvisieren Risiken eingehen und die Jazzmusik kommt oft auch humorvoll daher. All das hat sich offenbar auch auf Ihre Filme ausgewirkt. Wie würden Sie selber die Bedeutung von Musik beim Filmschaffen beschreiben? Mir scheint, dass gerade das Gefühl für Rhythmus sehr hilfreich ist, einen guten Film zu machen.
Rolf Lyssy: Musik ist ein ganz wichtiger Bestandteil eines Films. Es gibt Filme ohne Musik. Ich habe unlängst einen Dokumentarfilm von Frederick Wiseman angeschaut, einem legendären Filmschaffenden aus den USA. Der Film heisst “Ex Libris – The New York Public Library”. Er besteht aus puren dokumentarischen Aufzeichnungen. Es gibt im Film weder Musik noch Kommentare. Der Zuschauer betrachtet einfach, was uns der Filmer zeigt und vorführt. Ich fand das enorm faszinierend. Das heisst nicht, dass man im Dokumentarfilm nicht mit Musik arbeiten kann. Ich habe in meinem Dokumentarfilm „Ursula – Leben in Anderswo“ auch mit Musik gearbeitet. Wenn ein Film nicht funktioniert, wenn seine subkutane Wirkung aufs Publikum nicht gelingt, dann ist der Grund hierfür oft der Rhythmus, der im Film nicht stimmt. Insofern gebe ich Ihnen absolut Recht. Mit einem musikalischen Gespür kann man beim Filmen vieles besser machen.
Die Musik hat einen entscheidenden Anteil, wenn eine Geschichte erzählt wird, die in den Bauch gehen muss, dann braucht es die Musik. Die Musik, also die Töne, geht über die Ohren direkt in den Bauch. Die Bilder gehen nur in den Kopf. Eine gute Geschichte muss in den Kopf und in den Bauch.
Ich selber musste in Sachen Musik viel lernen. Es gibt zwei Filme, bei denen ich mit der Musik nicht wirklich zufrieden bin. Im Spielfilm „Ein klarer Fall“, es ging um den Fall Zwahlen, bin ich in Sachen Musik nicht zufrieden. Seither habe ich vermehrt die Kontrolle über die Musik in meinen Filmen übernommen. Ich komponiere sie nicht selber, aber es gibt engere Gespräche mit den Komponisten. Mir fällt es sehr schwer, Musik zu erklären. Ich kann das Genre erklären, aber nicht die Stimmung der Musik, die ich in einem Film haben will. Der Komponist muss mir in solchen Situationen Beispiele bringen. Am liebsten würde ich, wie das Woody Allen meisterhaft macht, Konservenmusik nehmen, also Musik, die man kennt. Das geht aber aus Kostengründen leider nicht, da diese Musik für den Einsatz in Filmen enorm teuer ist. Die Lizenzen kosten heute mehr als ganze Filmproduktionen.
Xecutives.net: Der Schweizer Filmschaffende Hans Liechti erzählte mir von seinem Film „Akropolis“ und meinte, dass man solche Filme, mit langen Sequenzen und langen Dialogen, heute nicht mehr machen könne. In modernen Filmen hingegen gäbe es heute schon fast eine Angst vor dem Bild. Man habe Angst, ein Bild länger zu zeigen, weil man dann auch qualitative Mängel erkennen könnte, was Filmschaffende verleite, sehr schnelle Schnitte zu produzieren und Bilder in Action-Szenen untergehen zu lassen.
Rolf Lyssy: Das ist sicher so, und zudem muss alles „vermusiziert“ werden, weil man eben nicht ans Bild glaubt. Damit soll das Bild retuschiert werden. Einen Film muss man geniessen können. Dafür muss der Zuschauer in der Lage sein, einen stummen Dialog mit den Schauspielern zu führen. Er muss hören, was sie sagen, er schaut sich die Geschichte an, bezieht vieles auf sich und auf sein eigenes Leben. Wenn dieser Prozess stimmt, dann ist der Zuschauer motiviert und zeigt sein Gefallen am Filmwerk.
Xecutives.net: Es bedarf aber auch guter Geschichten, so dass der Zuschauer diesen inneren Dialog mit den am Film beteiligten Personen führen will und kann. Dazu kommt nun aber auch die Komik, so bspw. in Ihrem Film „Leo Sonnyboy“, mit Matthias Gnädinger in der Hauptrolle, oder in „Die Schweizermacher“. Man verlässt den Kinosaal mit einem Lächeln auf den Lippen. Trotzdem kann man, auch wenn man alle diese Faktoren im Griff hat, nicht garantieren, dass ein Film ein Erfolg wird. Woran liegt das?
Rolf Lyssy: Jeder Film und jede Geschichte ist anders. Damit will ich nicht sagen, dass man immer wieder von Null anfängt. Wenn man die Technik im Griff hat, von Regie etwas versteht, weiss, wie man Filme macht und von Rhythmus eine Ahnung hat, ist das schon mal ganz gut. Ich bin selber auch Autor und weiss, wie schwierig es ist, gute Geschichten aufs Blatt zu bringen. Bis bei einem Filmprojekt alles zusammen funktioniert, muss man einen langen Prozess durchlaufen.
Ich habe vor zehn Jahren Dominik Bernet kennengelernt, der auch die Drehbücher zu „Kommissar Hunkeler“- und „Der Bestatter“-Filme geschrieben hat. Er ist selber Autor und Schriftsteller. Ich hatte das Glück, ihn damals kennenzulernen und zeigte ihm mein damaliges Exposé von „Die letzte Pointe“, meinem neusten Film. Es geht um eine ältere Dame, die Sterbehilfe beanspruchen will. Wir fingen damals an, zusammen zu schreiben. Wir sprachen und er schrieb, ich las, wir sprachen und er schrieb. Dieser Arbeitsprozess hat mir sehr gut gepasst. Nach meiner schweren Depression im Herbst 1998 hatte ich beschlossen, kein Drehbuch mehr zu schreiben. Ein Auslöser meiner Krankheit war die Tatsache, dass „Swiss Paradise“, ein Film, den ich damals produzieren wollte und für den ich auch das Drehbuch schrieb, nicht funktionierte. Ich war sehr enttäuscht und schockiert.
Xecutives.net: Was lief falsch mit dem Drehbuch?
Rolf Lyssy: Die Geschichte und Dramaturgie funktionierten nicht. Es gibt das Erfinden und das Schreiben, aber auch das Reflektieren und Analysieren. Bei diesem zweiten Teil der Arbeit am Filmprojekt stellte ich fest, dass die Geschichte nicht aufging. Ich selber habe ein hochentwickeltes kritisches Verhältnis zu mir selber, ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein. Man muss wirklich sehr kritisch sein mit seiner eigenen Arbeit, was nicht immer einfach ist. Mit Dominik Bernet klappten der Schreibprozess und das Analysieren später sehr gut. Es gab diese wunderbare Gemeinsamkeit im Denken. Dank dieser Zusammenarbeit gibt es heute ein gutes Drehbuch und den Film, der eben im Kino anlief.
Xecutives.net: Georg Kreisler erzählte von seiner Zusammenarbeit als junger Bursche mit Charlie Chaplin. Dieser konnte selber keine Noten schreiben, hatte aber gute musikalische Ideen. Kreisler musste ihm dann beim Pfeifen zuhören, schrieb die Noten auf und gab sie Chaplin. Ich fand diese Geschichte sehr spannend. Er äusserte sich, wie Professor Gottfried Schatz, auch über die Mittelmässigkeit, ein Phänomen, das sich nicht nur in der Unterhaltung, sondern auch in der Wirtschaft und in der Wissenschaft bemerkbar macht. Tatsächlich gibt es viel Mittelmässiges, in der Musik aber eben auch im Film. Viele Interviewpartner führen hier Rückschlüsse auf ein System, das zu dieser Mittelmässigkeit beisteuert. Was erkennen Sie hier in Bezug auf den Film in der Schweiz?
Rolf Lyssy: Es geht um die Substanz von Filmen und diese hat auch mit dem System zu tun. Filme wie „Höhenfeuer“ oder „Vitus“ von Fredi M. Murer, aber auch „Der schwarze Tanner“ von Xavier Koller sind Werke mit sehr viel Substanz. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren sehr guten Filmen in der Schweiz. Dazu gehören auch „Die göttliche Ordnung“ und „Grounding“. Es gab immer solche Filme, die über dem Durchschnitt sind und ausgeschlagen haben. Es gibt Unterschiede in Bezug auf die Zuschauerzahl. Weniger Zuschauer bedeutet aber nicht gezwungenermassen, dass ein Film weniger gut ist.
Wenn man die Masse der Filme anschaut, so dümpeln wir in der Schweiz sicher seit langer Zeit schon in der Mediokrität. Das ist aber auch angelegt in der Schweizer Mentalität, in der Denke. Demokratie, Ausgleich, Konsens, Überschaubarkeit, all das ist schön und gut, führt aber irgendwo systembedingt ins Mittelfeld. Wenn man in der Schweiz Erfolg hat, ist man suspekt. Das ist ein Symptom eines kleinen Landes. In den USA freuen sich die Menschen über einen neuen erfolgreichen Film, hier dagegen wird man kritisch betrachtet. Es geht um Neid und Missgunst. Das sage nicht nur ich, sondern auch andere Menschen, die erfolgreich sind.
Heute kann jeder, was die Technik betrifft, der kreativ tätig ist, einen Film machen. Das war früher anders. Es gab weniger Filmschaffende und man kannte sich. Nur wenige Menschen machten Filme. Die Frage ist, wie man mit all dem umgeht. Ich selber konzentriere mich auf mich selbst. Ich muss keine Filme mehr machen, um mich zu beweisen, sondern mich interessieren Themen, die auch die Gesellschaft beschäftigen und in der Öffentlichkeit diskutiert werden und die ich mit filmischen Mitteln erzählen möchte. In der Schweiz hat man es dann aber auch schnell mit Experten und Gremien zu tun, die über die finanzielle Unterstützung eines Filmprojektes entscheiden und sich inhaltlich einmischen. Der Film ist ein teureres Medium. Findet man die Finanzen nicht, kann man einen Film nicht realisieren. Hier in der Schweiz ist der Markt zu klein, damit Banken und vermögende Leute in Filme investieren würden. Mit Filmen lässt sich in einem kleinen Land wie der Schweiz nur schwer grosse Kasse machen. Er kann nicht amortisiert werden. Wir haben die Situation, dass wir darum ohne Subventionen gar nicht selber Filme machen können. Das geht bei der Debatte über Filme und deren Finanzierung leider oft vergessen.
Xecutives.net: Mittelmässige Filme sind aber oft nicht nur aufgrund der Finanzierung mittelmässig, sondern auch aufgrund mittelmässiger Geschichten und mittelmässiger Regie…
Rolf Lyssy: Das ist nun ein ganz heikles Thema, aber Sie haben natürlich Recht. Der Film ist Resultat von Drehbuchautoren, von Regisseuren und Schauspielern. Verfügen diese nur über eine beschränkte Begabung, dann kann kein guter Film entstehen. Die Technik kann man immer erlernen. Man kann auch virtuos sein in irgendetwas. Viele verfügen aber nicht über das richtige Gespür, wie man eine Geschichte erzählen muss, damit sie die Zuschauer erreicht. Es besteht oft auch ein falsches Verständnis des Filmemachens. Ich selber mache ja nicht Filme nur für meine Familie und für meine Freunde, sondern für eine grosse Zuschauerzahl. Ich bin mit dem Zuschauer konfrontiert, auch wenn er mich nicht kennt. Er geht ins Kino, zahlt Geld und will dafür etwas sehen, was vollkommen in Ordnung ist. Man muss also eine gewisse Ethik und ein Arbeitscredo haben. Damit meine ich, in der Schuld des Zuschauers zu stehen. Es geht hier aber nicht darum, etwas zu tun, das der Zuschauer hören und sehen will, um in seiner Gunst zu stehen. Das funktioniert vielfach überhaupt nicht.
Xecutives.net: Georg Kreisler beschrieb das mit „Publikumsfreudigkeit“. Comedy bestehe eben vorwiegend darin, das zu tun, was das Publikum hören und sehen möchte.
Rolf Lyssy: Das Publikum will unterhalten werden, was völlig legitim ist. Es darf nicht das Gefühl bekommen, dass es die Zeit vertrödelt hat. Ich selber will, dass der Zuschauer im Kinosaal etwas erhält, was ihn inspiriert, worüber er lachen und vielleicht weinen muss und der Zuschauer nach dem Film erfüllt den Saal verlässt. Das können also Freuden- oder Trauertränen sein, die während des Films fliessen. Es gibt kein Filmerfolg, der stattfindet, ohne dass Zuschauer weitererzählen, dass der Film toll sei. Wenn das nicht passiert, so nützt jede Plakatkampagne nichts.
Xecutives.net: Es geht im Kino auch ein bisschen um Seelenwellness, man lacht gerne und man hat am Ende des Filmes ein gutes Gefühl…
Rolf Lyssy: Das ist schön gesagt: Seelenwellness. Und Lachen ist gesund! Das ist das einfachste Sprichwort, das es gibt. Es ist aber so, das Lachen ist ein Reflex. Man kann aber nur lachen, wenn man etwas verstanden hat, das zum Lachen ist. Das Spiel mit Humor muss einem gegeben sein. Entweder hat man diesen Sinn für Humor oder nicht. Menschen, die dieses Spiel mit dem Humor beherrschen, sind oft Menschen, die auch über sich selber lachen können.
Xecutives.net: Auch dieser Punkt, der Humor, hat mit Jazz zu tun. Joe Turner sagte mir immer wieder, Stride Piano ist „music that makes happy!“. Er hatte völlig Recht. Der Klavierstil erzeugt bei den meisten Menschen ein Lächeln auf den Lippen.
Rolf Lyssy: Das sagte auch Thomas „Fats“ Waller, der grosse Übervater des Stride Piano. Und auch hier gilt der Titel eines sehr bekannten Songs: „It don’t mean a thing, if you ain’t got that swing.“ Dieser Satz beschreibt sehr treffend, was Sie eben gesagt haben. Wenn der Jazz nicht swingt, so ist es Kopfmusik. Darum mag ich Free Jazz nicht besonders. Der Kern des Jazz stammt aus dem Blues, eine Musik, die aus dem Leiden entstanden ist. Schwarze Baumwollpflücker haben diese Musik erfunden. Menschen, die in Minderheiten leben, die ausgegrenzt und verfolgt werden, aus welchen Gründen auch immer, drücken ihr Leid und ihre Lebensfreude mit Musik aus. Der Jazz ist hier ein schönes Beispiel. Wir haben grosse Jazz-Schulen, die Musiker auf den Markt spülen. Nur das Technische reicht aber nicht, um diese Musik glaubhaft rüberzubringen. Und genau so ist das auch beim Film.
Xecutives.net: Sie haben jüdische Wurzeln. Buddy Elias erzählte mir einen Witz, einen jüdischen Witz, in dem ein Leiter eines Konzentrationslagers eine Rolle spielt. Der Witz hat etwas Lustiges, er hat aber auch etwas sehr Ernstes an sich. Der Witz beinhaltet also beides, Leid und Freude, so wie das auch bei der Klezmer Musik der Fall ist. Sie haben schon früh den Film „Konfrontation“ über David Frankfurter, der in Davos den Nazi Wilhelm Gustloff erschossen hat, gedreht. Hans Theodor Sieber hat in einem sehr interessanten Interview als Zeitzeuge über diese Tat und die damalige Zeit berichtet. Er war damals als Junge in Davos und bekam das alles mit, auch die vielen Nationalsozialisten, die sich dort zu tummeln pflegten. Ist dieser Film eine Auseinandersetzung mit ihren jüdischen Wurzeln?
Rolf Lyssy: Die Geschichte um David Frankfurter ist ein grosses Drama. 1905 waren meine Grosseltern mütterlicherseits aus Russland geflüchtet und nach Frankfurt emigriert. Mein Grossvater war Operettensänger und Kantor in der Synagoge. 1941 wurden sie deportiert und ermordet. Mein Vater verfolgte zu Hause mit einer Europakarte an der Wand des Wohnzimmers den Frontverlauf. Ich habe das alles mitbekommen, was an Schrecklichem passiert ist. Im Seefeld, wenn Fliegeralarm war, mussten wir beim Ertönen der Sirenen in den Keller und nachts die Fenster abkleben, so dass die Piloten die Wohn- und Ballungsgebiete nicht ausmachen konnten. Dieser unsägliche und fürchterliche Krieg und der Holocaust haben mich schon als Kind sehr beschäftigt und ich fragte mich schon damals, warum sich diese Juden und andere Minderheiten denn nicht wehrten. Solche Gedanken gingen mir damals, 12 Jahre alt, durch den Kopf. Ich las Karl May Romane und dachte mir, dass wenn einem solches Unrecht geschieht, man doch zurückschiessen müsste. Als ich 1961 in der Zeitschrift «Sie & Er» einen Artikel von Rolf W. Schloss, der auch nach Israel ging und dort David Frankfurter kennenlernte, las, liess mich dieser Stoff nicht mehr los. Mir ging das nicht mehr aus dem Kopf, ein Jude, der 25 Jahre zuvor einen Nazi in der Schweiz erschoss. Mir war klar, dass das Thema für einen Film ist. 1968 schrieb ich ein Exposé und machte mich ab 1969 an die Drehbucharbeit. Ich wollte aber keinen Dokumentarfilm, sondern einen Spielfilm drehen. Ich lernte David Frankfurter ebenfalls kennen und führte mit ihm in Israel, wo er seit 1945, nach seiner Entlassung aus dem Zuchthaus in Chur, lebte, stundenlange Gespräche. Das war enorm interessant.
1945 wurde David Frankfurter in der Schweiz begnadigt und ging nach Israel. Ich war in der Wohnung von Gustloff. Da war immer noch ein Schussloch in der Wand. Ich hatte auch Gerichtsprotokolle gelesen, lernte Menschen kennen, die am Prozess mit dabei waren. Ich war für den Film bestens vorbereitet und wollte die Geschichte möglichst nahe an der Wahrheit haben und an der Wirklichkeit. Der Film wurde 1975 am Filmfestival in Cannes gezeigt und ich konnte ihn in viele Länder verkaufen.
Xecutives.net: Es gibt zwischen diesem Film und „Die Schweizermacher“ natürlich Parallelen. Es geht in beiden Fällen um Behörden, Willkür und um Ausgrenzung.
Rolf Lyssy: Es geht vordergründig um das Thema Einbürgerung. Ausländer wollen Schweizer werden. Im Kern jedoch geht es um die Identität eines Landes, um die Frage wer wir sind, was ein Schweizer ist und wer sagt, wer ein Schweizer sein darf und wie er leben soll. Wenn man sagt, wenn man Schweizer ist, dann bedeutet das, dass man die Sprache kann, dass man hier geboren und aufgewachsen ist, dann ist das keine taugliche Definitionen mehr. Heute kann ein Schwarzer oder ein Asiat Berndeutsch reden und ein Schweizer sein. Wer aber masst sich an, die Identität zu definieren? Das ist eine grosse Frage, die uns auch heute beschäftigt. Darum schaut man den Film heute noch.
Xecutives.net: Die Schweiz war lange Zeit auch ein Land, das viele Menschen verlassen haben, dem viele Menschen den Rücken gekehrt haben, weil man sie aus religiösen Gründen gegängelt hat oder aus rein wirtschaftlichen Gründen, weil ihnen die Schweiz nichts zu bieten hatte. Hans Theodor Sieber beschreibt das sehr schön im Interview. Er erzählt, wie er als Lehrling bei Kuoni in Bern den Ausreisenden habe 5 Franken abknöpfen müssen, für den Fall, dass sie auf dem Weg nach Kanada und in andere Länder starben. Die 5 Franken waren das Geld für das eigene Begräbnis. Wir haben das heute offenbar weitgehend verdrängt. Sowieso wissen viele Menschen nicht mehr sehr viel über das, was hier noch vor wenigen Jahrzehnten passiert ist.
Rolf Lyssy: Es spielt hier unsere Kleinheit eine grosse Rolle. Wir sind eines der kleinsten Länder auf der Welt. Wir befinden uns mitten in Europa, umgeben von grossen Ländern wie damals Österreich-Ungarn, Deutschland, Italien und Frankreich. Mitten drin liegt die Schweiz, die es nie gern hatte, wenn man sich in ihre Angelegenheiten einmischte. Wir sind heute aber mit den offenen Grenzen konfrontiert. Es spielen sich hier auf engstem Raum menschliche Prozesse ab. Das Resultat dieser Denkprozesse muss völlig anders sein, als wenn man in den USA lebt, mit riesigen Flächen. Das prägt die Menschen. Nicht nur wie der Mensch aufwächst. Das Denken in Arizona oder in einer Stadt wie New York, oder hier in Leukerbad oder Luzern, umgeben von Bergen, wo sich jeder kennt, kann nicht das gleiche sein. Wir werden somit auch von der Geografie geprägt. Die Natur und Umgebung prägen uns, auch schon hier in unserem eigenen Land. Wir haben Bergler und Städter. Das wird oft in den politischen Prozessen gar nicht beachtet. Die Masseninitiative ist von den Städten, die viele Ausländer haben, mehrheitlich abgelehnt worden, jedoch von den ländlichen Gegenden, wo weniger Ausländer leben, gutgeheissen worden. Das zeigt die Komplexität der Thematik.
In Bezug auf das Filmschaffen wäre es schön, wir wären ein grösseres Land. Hätten wir heute das Veltlin und die Lombardei, mit Anstoss ans Mittelmeer, so hätte das auch Einfluss auf das Filmschaffen in der Schweiz. Es war hier in der Schweiz immer eine Art der Bedrohung allgegenwärtig. Der Wiener Kongress 1815 hätte auch ganz anders rauskommen können. Wir Schweizer hatten sehr viel Glück, auch im Zweiten Weltkrieg. Wenn man so überlebt in den letzten 400 Jahren, dann besteht die Gefahr, dass man überheblich wird und sich für ein auserwähltes Volk hält. Es ist auch überheblich, wenn offiziell in Wohnungen rumgeschaut wird, ob man schweizerisch wohnt, so wie das im Film „Die Schweizermacher“ etwas überspitzt dargestellt wird. Das ist aber bis heute so. Man kann heute darüber lachen, weil ich das komisch erzähle. Man hätte aber auch ein Drama daraus machen können. Es gab viele Ausländer, deren Leben vernichtet wurde, Menschen, die wieder weggingen, weil man sie gängelte. Mit der Komödie geht es aber besser, die Menschen mit einem Thema zu beschäftigen. Es geht um das Lachen und um das Verstehen. Das macht die Komödie zum schwersten Genre innerhalb des Films und des Theaters.
Xecutives.net: Wir sichern uns an allen Ecken ab, eine weitere Eigenschaft der Schweizerinnen und Schweizer. Das liegt offenbar ebenfalls im Naturell, in unserem Volkscharakter.
Rolf Lyssy: Wir haben Angst, dass wir eines Tages, als eingeborene Schweizer untergehen könnten. Diese Angst ist eingebildet. Die Bewegungen, die stattfinden, können nicht aufgehalten werden. Es ist alles in Bewegung und Veränderung kann Angst machen. Es gibt Menschen, die vor Veränderungen Angst haben und sich den Traditionen zuwenden. Der Mensch verändert sich aber ständig. Wir werden auch älter. Diesen Prozess kann man nicht katalogisieren und einfach sagen, früher sei es so oder anders gewesen. Diese Flexibilität fällt den Schweizern schwer. Wir versuchen lieber, uns abzusichern. Dieses „auf Sicher gehen“, ist bei uns in den Genen angelegt, lässt sich aber erklären. Wir haben keine Bodenschätze und müssen unsere Existenz mit dem sichern, was wir machen. Ja, wir haben etwas Wasser für Elektrizität. Wir müssen aber für alles andere, das wir haben, arbeiten.
Der Schweizer ist auf Sicherheit bedacht. Risiken müssen zuerst minimiert werden. Beim Film aber, braucht es Gambler. Oft kommt es, wie es kommt. Wir sind keine Spielernaturen wie die Amerikaner, sondern mehr handfest veranlagt. Eine Strasse bauen wir für 300 Jahre. Mit diesem Mindset aber lassen sich keine guten Filme machen. Man muss bereit sein, auch Risiken einzugehen, mit anderen Worten gesagt, den Preis zu bezahlen. Ich habe immer selbständig gearbeitet. Mein Beruf kostet Geld und ich musste immer Wege finden, die Filme finanzieren zu können. Das ist ein Hochseilakt ohne Netz. Entweder man ist bereit dazu, dann kann man erfolgreich werden, oder eben nicht. Viele Filmschaffende haben diese Gratwanderung nicht geschafft und sind abgestürzt oder sie haben sich gar umgebracht.
Xecutives.net: Sie waren bei Giacun Caduff am Basler Gässli Film Festival. Der Regisseur und Produzent Caduff entscheidet seit Kurzem auch über die Verleihung der Oscars, ein toller und wohlverdienter Karriereschritt. Sie haben an diesem Festival für Kurzfilme viele junge Filmemacher und Filmfans kennengelernt. Was können Sie diesen jungen Menschen geben?
Rolf Lyssy: Er hatte mich in den letzten zwei Jahren angefragt, ob ich gerne ans Festival kommen würde. Ich musste ihm aus zeitlichen Gründen absagen, dieses Jahr sagte ich zu. Mich hat sein Elan fasziniert und ich habe die Zeit am Festival sehr genossen. Ich kann diesen jungen Menschen nichts geben. Sie müssen selber wissen, was sie wollen. Ich kann ihnen nur zeigen, dass es eben Rückschläge, Frustrationen, Kränkungen und Verletzungen gibt, es sich aber trotzdem lohnt, dranzubleiben. Filmemachen heisst nicht, nur einen kurzen Sprint hinzulegen, sondern einen Marathon zu laufen.
Es gibt hierzulande viele junge Kolleginnen und Kollegen, die gezeigt haben, dass sie was drauf haben. Ich drücke ihnen die Daumen. Bis sie dann den Durchbruch erleben können, bin ich vermutlich selber nicht mehr da. Es gibt kein Recht zum Filme machen, aber, wer die Begeisterung und das Talent hat, soll Filme machen dürfen.
Xecutives.net: Herr Lyssy, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin gutes Gelingen bei Ihren Filmprojekten!
(C) 2017 by Christian Dueblin. Alle Rechte vorbehalten. Anderweitige Publikationen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors gestattet.